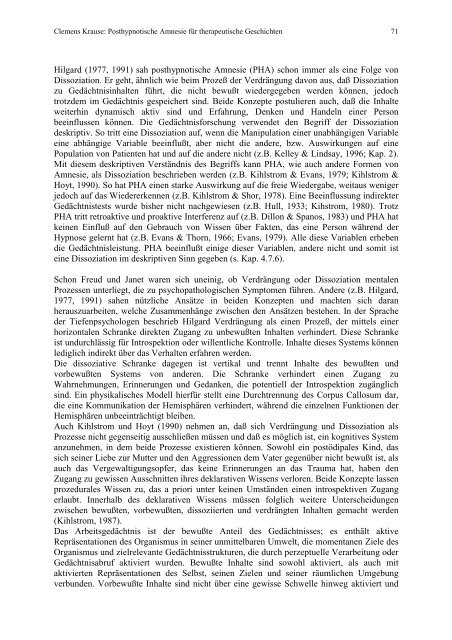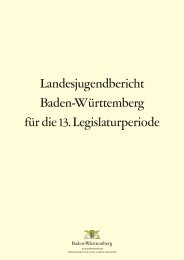Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 71<br />
Hilgard (1977, 1991) sah posthypnotische Amnesie (PHA) schon immer als eine Folge von<br />
Dissoziation. Er geht, ähnlich wie beim Prozeß der Verdrängung davon aus, daß Dissoziation<br />
zu Gedächtnisinhalten führt, die nicht bewußt wiedergegeben werden können, jedoch<br />
trotzdem im Gedächtnis gespeichert sind. Beide Konzepte postulieren auch, daß die Inhalte<br />
weiterhin dynamisch aktiv sind und Erfahrung, Denken und Handeln einer Person<br />
beeinflussen können. Die Gedächtnisforschung verwendet den Begriff der Dissoziation<br />
deskriptiv. So tritt eine Dissoziation auf, wenn die Manipulation einer unabhängigen Variable<br />
eine abhängige Variable beeinflußt, aber nicht die andere, bzw. Auswirkungen auf eine<br />
Population von Patienten hat und auf die andere nicht (z.B. Kelley & Lindsay, 1996; Kap. 2).<br />
Mit diesem deskriptiven Verständnis des Begriffs kann PHA, wie auch andere Formen von<br />
Amnesie, als Dissoziation beschrieben werden (z.B. Kihlstrom & Evans, 1979; Kihlstrom &<br />
Hoyt, 1990). So hat PHA einen starke Auswirkung auf die freie Wiedergabe, weitaus weniger<br />
jedoch auf das Wiedererkennen (z.B. Kihlstrom & Shor, 1978). Eine Beeinflussung indirekter<br />
Gedächtnistests wurde bisher nicht nachgewiesen (z.B. Hull, 1933; Kihstrom, 1980). Trotz<br />
PHA tritt retroaktive und proaktive Interferenz auf (z.B. Dillon & Spanos, 1983) und PHA hat<br />
keinen Einfluß auf den Gebrauch von Wissen über Fakten, das eine Person während der<br />
Hypnose gelernt hat (z.B. Evans & Thorn, 1966; Evans, 1979). Alle diese Variablen erheben<br />
die Gedächtnisleistung. PHA beeinflußt einige dieser Variablen, andere nicht und somit ist<br />
eine Dissoziation im deskriptiven Sinn gegeben (s. Kap. 4.7.6).<br />
Schon Freud und Janet waren sich uneinig, ob Verdrängung oder Dissoziation mentalen<br />
Prozessen unterliegt, die zu psychopathologischen Symptomen führen. Andere (z.B. Hilgard,<br />
1977, 1991) sahen nützliche Ansätze in beiden Konzepten und machten sich daran<br />
herauszuarbeiten, welche Zusammenhänge zwischen den Ansätzen bestehen. In der Sprache<br />
der Tiefenpsychologen beschrieb Hilgard Verdrängung als einen Prozeß, der mittels einer<br />
horizontalen Schranke direkten Zugang zu unbewußten Inhalten verhindert. Diese Schranke<br />
ist undurchlässig für Introspektion oder willentliche Kontrolle. Inhalte dieses Systems können<br />
lediglich indirekt über das Verhalten erfahren werden.<br />
Die dissoziative Schranke dagegen ist vertikal und trennt Inhalte des bewußten und<br />
vorbewußten Systems von anderen. Die Schranke verhindert einen Zugang zu<br />
Wahrnehmungen, Erinnerungen und Gedanken, die potentiell der Introspektion zugänglich<br />
sind. Ein physikalisches Modell hierfür stellt eine Durchtrennung des Corpus Callosum dar,<br />
die eine Kommunikation der Hemisphären verhindert, während die einzelnen Funktionen der<br />
Hemisphären unbeeinträchtigt bleiben.<br />
Auch Kihlstrom und Hoyt (1990) nehmen an, daß sich Verdrängung und Dissoziation als<br />
Prozesse nicht gegenseitig ausschließen müssen und daß es möglich ist, ein kognitives System<br />
anzunehmen, in dem beide Prozesse existieren können. Sowohl ein postödipales Kind, das<br />
sich seiner Liebe zur Mutter und den Aggressionen dem Vater gegenüber nicht bewußt ist, als<br />
auch das Vergewaltigungsopfer, das keine Erinnerungen an das Trauma hat, haben den<br />
Zugang zu gewissen Ausschnitten ihres deklarativen Wissens verloren. Beide Konzepte lassen<br />
prozedurales Wissen zu, das a priori unter keinen Umständen einen introspektiven Zugang<br />
erlaubt. Innerhalb des deklarativen Wissens müssen folglich weitere Unterscheidungen<br />
zwischen bewußten, vorbewußten, dissoziierten und verdrängten Inhalten gemacht werden<br />
(Kihlstrom, 1987).<br />
Das Arbeitsgedächtnis ist der bewußte Anteil des Gedächtnisses; es enthält aktive<br />
Repräsentationen des Organismus in seiner unmittelbaren Umwelt, die momentanen Ziele des<br />
Organismus und zielrelevante Gedächtnisstrukturen, die durch perzeptuelle Verarbeitung oder<br />
Gedächtnisabruf aktiviert wurden. Bewußte Inhalte sind sowohl aktiviert, als auch mit<br />
aktivierten Repräsentationen des Selbst, seinen Zielen und seiner räumlichen Umgebung<br />
verbunden. Vorbewußte Inhalte sind nicht über eine gewisse Schwelle hinweg aktiviert und