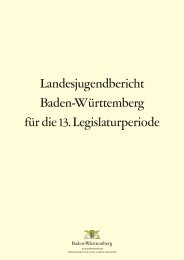Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 86<br />
die anterograde Amnesie zu erheben. Vorliegende Ergebnisse deuten darauf hin, daß die<br />
Amnesie vorübergehend extensiv und abgestuft ist und sowohl autobiographische aber auch<br />
öffentliche Ereignisse umfaßt (Hodges, 1995). Auf der einen Seite gibt es eine Störung<br />
jeglichen Abrufs aus einem begrenzten Zeitraum vor der Attacke, der auch mehrere Jahre<br />
zurück reichen kann. Persönliche und öffentliche Umstände werden so wahrgenommen als<br />
hätte die Person die Zeit danach nicht erlebt. Auf der anderen Seite kann es aber auch zu<br />
einem unregelmäßigeren Gedächtnisverlust kommen, der mehrere Jahrzehnte zurück reicht.<br />
Patienten sind in diesem Fall in der Lage die wichtigsten autobiographischen und öffentlichen<br />
Ereignisse wiederzugeben, den Schilderungen fehlt es jedoch an Farbe und Details (Hodges &<br />
Ward, 1989). Die chronologische Reihenfolge der erinnerten Ereignisse kann typischerweise<br />
nicht bestimmt werden (s. Hodges, 1995).<br />
Das semantische Gedächtnis scheint unbeeinträchtigt, insofern es sich auf allgemeines Wissen<br />
bezieht. Autobiographisches Wissen jedoch (z.B. Namen von Klassenkameraden), ist defizitär<br />
(Hodges & Ward, 1989). Ein Aspekt der im Falle der PGA noch nicht ausreichend überprüft<br />
wurde, ist das implizite Gedächtnis. Goldenberg (1995) beschreibt zwei Fälle in denen<br />
implizites Lernen während der Attacke erfolgte. In einem Fall bestand der Lernerfolg auch<br />
nach der Attacke noch, während er im anderen Fall teilweise wieder verloren ging.<br />
Bei einigen Patienten kann auch eine Einschränkung anderer kognitiver Funktionen gefunden<br />
werden. Verringerte Wortflüssigkeit sowie Beeinträchtigungen beim Kopieren komplexer<br />
Figuren kennzeichnet diejenigen Funktionen, die am häufigsten bei Patienten während einer<br />
Amnesieattacke betroffen sind.<br />
Die PGA hinterläßt auch nach der Reversibilität eine Gedächtnislücke für die amnestische<br />
Episode, die sich auf eine Stunde vor dem Einsetzen der Attacke erstrecken kann. Klinisch<br />
gilt die Amnesie dann für beendet, wenn Verhalten und Alltagsgedächtnis unauffällig sind.<br />
Neuropsychologische Nachuntersuchungen zeigen jedoch, daß die Wiederherstellung der<br />
normalen Gedächtnisfunktion langsamer vorangeht als es die subjektiven Erfahrungen der<br />
betroffenen Person andeuten. Eine völlig unauffällige Leistung in Gedächtnistests wird erst<br />
nach Tagen oder sogar Wochen erreicht (Goldenberg, 1995, Hodges & Ward, 1989).<br />
Mit Hilfe bildgebender Verfahren (CT, rCBF, SPECT) konnten bei Patienten mit PGA<br />
Anomalien in verschiedenen Gehirnregionen beobachtet werden. Teilweise betreffen diese<br />
jedoch keine gedächtnisrelevanten Strukturen und somit ist der kausale Zusammenhang<br />
zwischen Pathologie und dem Auftreten der Amnesie unklar (Goldenberg, 1995).<br />
Die Inzidenz für das Auftreten der PGA beträgt drei Fälle pro 100000 Personen (Hodges,<br />
1991). Meistens tritt die PGA einmalig auf, lediglich bei 2 bis 5 % der Patienten tritt sie<br />
mehrfach innerhalb von einigen Jahren auf. Die Mehrzahl der Patienten sind 50 bis 70 Jahre<br />
alt. Die Altersstruktur unterscheidet sich von anderen cerebrovaskulären Erkrankungen. Es<br />
besteht allgemein Uneinigkeit darüber in wieweit Patienten mit PGA Risikofaktoren für<br />
vaskuläre Erkrankungen in sich tragen. Die Komorbidität mit Migräne beträgt ca. 20 % (z.B.<br />
Hodges & Warlow, 1990) und ist damit signifikant höher als bei einer Population gesunder<br />
Personen. Insgesamt läßt sich feststellen, daß die PGA eine eigenständige Störung ist und daß<br />
ein Bezug zu anderen häufiger auftretenden Erkrankungen nur schwer herzustellen ist.<br />
Gegenwärtig gibt es zwei Hypothesen für Ätiologie und Pathogenese der PGA. Eine<br />
postuliert, daß vaskuläre Verschlüsse eine vorübergehende Ischämie entweder im<br />
Hippocampus oder dem Thalamus verursachen (Frederiks, 1990), die andere postuliert eine<br />
sich ausbreitende Hemmung (Depolarisation von Neuronen, die sich in benachbartes Gewebe<br />
ausbreitet und für eine gewisse Zeit das Funktionieren der betroffenen Nervenzellen<br />
verhindert), die zu vorübergehender Dysfunktion des Hippocampus führt (Olesen &<br />
Jorgensen, 1986). Keiner der beiden Hypothesen kann jedoch nach dem gegenwärtigen<br />
Forschungsstand der Vorzug gegeben werden.