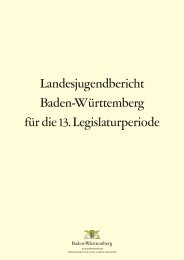Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 67<br />
Feedback über die Persönlichkeit), der mit dem gelernten Material in Zusammenhang<br />
gebracht wurde. Dadurch sollte das ursprünglich neutrale Material angstbesetzt werden.<br />
Bei einem anschließenden Wiedergabetest erinnerten die Pbn der Streßbedingung weniger<br />
als die Kontrollgruppe, die keinem Streß ausgesetzt wurde. Nun wurde der Streß wieder<br />
beseitigt, indem die Pbn der Experimentalbedingung positives Feedback erhielten. Ein<br />
erneuter Wiedergabetest zeigte sich dann eine verbesserte Wiedergabe des Materials und<br />
es gab keine Unterschiede in der Gedächtnisleistung, verglichen mit der Kontrollgruppe<br />
(z.B. Holmes, 1972). Es ist aber auch in diesem Fall nicht gesagt, daß Verdrängung diese<br />
Effekte verursacht. Denkbar wäre auch, daß die Wiedergabe des Materials mit dem Streß<br />
interferierte. So kann eine Versagenssituation einen Zustand provozieren, welcher das<br />
Testergebnis durch das Auslösen konkurrierender Reaktionen beeinflußt. Ein anderes<br />
Ergebnis zeigte außerdem, daß auch sehr positives Feedback die Gedächtnisleistung im<br />
Vergleich mit einem neutralen Feedback verschlechterte. Deshalb sind wohl doch eher<br />
Interferenzeffekte für die schlechtere Wiedergabe unter Streß verantwortlich. Dafür<br />
spricht auch die Tatsache, daß Wörter, die einen Bezug zum induzierten Streß hatten,<br />
nicht eher vergessen wurden als neutrale Wörter.<br />
• Auswirkung von individuellen Unterschieden auf Verdrängung: Ein individueller<br />
Unterschied, der angeführt wird, um unterschiedliche Tendenzen zu erklären, Inhalte zu<br />
verdrängen, ist der zwischen „Verdrängern“ und „Sensitivierern“ (Byrne, Barry & Nelson,<br />
1963). Anhand bestimmter Items des Minnesota Multiphasic Personality Inventory<br />
(MMPI) werden die Personen gefragt, ob sie gewisse Symptome bei sich feststellen.<br />
Diejenigen, die eine besonders niedrige Anzahl von Symptomen berichten, gelten als<br />
„Verdränger“; diejenigen, die eine besonders hohe Anzahl von Symptomen berichten, als<br />
„Sensitivierer“. Die Scala klassifiziert allerdings Personen, die tatsächlich keine<br />
Symptome haben und deswegen auch keine berichten, fälschlicherweise als Verdränger.<br />
Deshalb sind die Ergebnisse auch nicht besonders aussagefähig. Andere individuelle<br />
Unterschiede, die konsistent gefunden wurden, zeigen, daß Personen mit hohem Anspruch<br />
an die eigene Leistung unter großem Streß mehr unvollendete Aufgaben erinnern als unter<br />
geringem Streß. Es scheint so, als ob diese Personen mehr über ihr Versagen nachdenken,<br />
wenn sie mit unlösbaren Aufgaben konfrontiert werden; ein Ergebnis, das der Theorie der<br />
Verdrängung widerspricht (z.B. Weiner, 1965). Ein weiterer Ansatz mißt soziale<br />
Erwünschtheit und Angst. Personen, die ein hohes Maß an sozialer Erwünschtheit zeigen<br />
und niedrige Angstwerte aufweisen werden als „Verdränger“ klassifiziert und berichten<br />
seltener als andere Pbn über unangenehme, streßreiche Ereignisse. Trotzdem zeigen diese<br />
Personen eine höhere physiologische Erregung beim Berichten der Ereignisse. Wäre das<br />
Material verdrängt, dürften sie sich dessen nicht bewußt sein und folglich auch keine<br />
Erregung zeigen. Somit scheint es sich hier eher um einen anderen Abwehrmechanismus,<br />
nämlich Verleugnung zu handeln (Holmes, 1990).<br />
• Wahrnehmungsabwehr: Diese betrifft das Phänomen der primären Verdrängung, d.h. ein<br />
Stimulus wird gar nicht erst als bedrohlich wahrgenommen, sondern gelangt direkt ins<br />
Unterbewußte. Ergebnisse konnten zunächst zeigen, daß Wörter, die Streß induzieren,<br />
länger dargeboten werden müssen, bevor sie die Pbn identifizierten. Es stellte sich jedoch<br />
heraus, daß diese Wörter weniger geläufig waren als die neutralen Wörter. Zudem bestand<br />
die Tendenz, Wörter, die Streß induzieren und teilweise obszön waren, erst genau zu<br />
identifizieren, bevor sie benannt wurden. Wurde der Einfluß dieser Variablen<br />
ausgeschaltet, verschwanden auch die Effekte.<br />
Erdelyi (1990) ist der Meinung, daß Ebbinghaus 1885 die erste experimentelle Studie<br />
veröffentlichte, die zeigte, daß Verdrängung Amnesie erzeugen kann. Die Vergessenskurve<br />
von Ebbinghaus zeigt, daß wir mit dem Verstreichen von Zeit vergessen. Jedoch deuten<br />
Ergebnisse von Erdelyi und Kleinbard (1978) in eine völlig andere Richtung. Sie erhielten