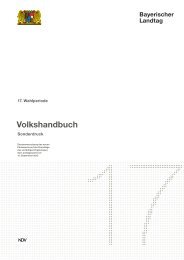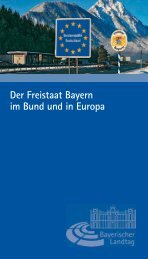Schlussbericht (Drs. 16/17740) - Bayerischer Landtag
Schlussbericht (Drs. 16/17740) - Bayerischer Landtag
Schlussbericht (Drs. 16/17740) - Bayerischer Landtag
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Seite 144 <strong>Bayerischer</strong> <strong>Landtag</strong> • <strong>16</strong>. Wahlperiode Drucksache <strong>16</strong>/<strong>17740</strong><br />
Daher ist anzunehmen, dass diese Darstellung der BAO<br />
Bosporus im Sachstandsbericht bereits die Grundlage für die<br />
spätere Empfehlung der OFA Bayern zur Medienstrategie<br />
und schließlich für das Ergebnis war.<br />
Diese Konzeption für die Medien wurde sowohl mit der<br />
Staatsanwaltschaft als auch dem Bayerischen Staatsministerium<br />
des Innern abgesprochen. Dies haben die Zeugen Dr.<br />
Kimmel und Dr. Günther Beckstein vor dem Untersuchungsausschuss<br />
bestätigt.<br />
Der Untersuchungsausschuss bewertet die bewusst nachrangige<br />
Behandlung des möglichen ausländerfeindlichen Hintergrundes<br />
als Fehler der Behörden im Rahmen einer falsch<br />
verstandenen Rücksichtnahme. Die Chance auf zielführende<br />
Hinweise aus der Bevölkerung hätte im Rahmen der Abwägung<br />
mit dem Risiko einer Beunruhigung der türkischen<br />
Bevölkerung zu einer transparenten und zielgerichteten Medienstrategie<br />
mit einer die rechte Spur umfassenden Information<br />
der Öffentlichkeit führen müssen.<br />
3.7. Probleme in der Zusammenarbeit zwischen der BAO<br />
Bosporus und dem Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz<br />
3.7.1. Rechtliche Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen<br />
Polizei und Verfassungsschutz<br />
Bei dem sog. Trennungsgebot handelt es sich nicht um ein<br />
Kooperationsverbot zwischen den Behörden.<br />
Der „Polizeibrief“ der West-Alliierten vom 14. April 1949<br />
gilt als Grundlage des Trennungsgebotes. Dort heißt es:<br />
Bereits nach dem Wortlaut soll also der Verfassungsschutz<br />
keine Polizeibefugnis erhalten. Nach Sinn und<br />
Zweck der Vorgabe soll jedoch über den Wortlaut hinaus<br />
im Gegenzug die Polizei nur mit polizeilichen und nicht<br />
mit nachrichtendienstlichen Mitteln arbeiten dürfen.<br />
Artikel 87 Absatz 1, Satz 2 des Grundgesetzes enthält die<br />
Unterscheidung zwischen Polizeibehörden und dem Verfassungsschutz<br />
und voneinander getrennt unterhaltenen Zentralstellen.<br />
In einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus<br />
dem Jahre 1998 849 wurde unter Bezugnahme auf Art. 87<br />
Absatz 1, Satz 2 des Grundgesetzes klargestellt, dass sich<br />
das Trennungsgebot auch aus dem im Grundgesetz enthaltenen<br />
Rechtsstaatsprinzip, dem Bundesstaatsprinzip und<br />
dem Schutz der Grundrechte ergibt.<br />
Ausfluss des Trennungsgebotes sind die Regelungen im<br />
Bundesverfassungsschutzgesetz. Dort heißt es:<br />
§ 2 Verfassungsschutzbehörden<br />
(1) ...Das Bundesamt für Verfassungsschutz darf einer polizeilichen<br />
Dienststelle nicht angegliedert werden.<br />
§ 8 Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz<br />
(3) Polizeiliche Befugnisse oder Weisungsbefugnisse<br />
stehen dem Bundesamt für Verfassungsschutz nicht zu;<br />
es darf die Polizei auch nicht im Wege der Amtshilfe um<br />
Maßnahmen ersuchen, zu denen es selbst nicht befugt ist.<br />
Das Trennungsgebot verbietet zunächst in organisatorischer<br />
Hinsicht die Angliederung des Verfassungsschutzes an die<br />
Polizeidienststellen und untersagt den Gebrauch polizeilicher<br />
Zwangsbefugnisse.<br />
Hierzu führt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil<br />
zum Antiterrordatei-Gesetz folgendes aus:<br />
„Die Rechtsordnung unterscheidet damit zwischen einer<br />
grundsätzlich offen arbeitenden Polizei, die auf eine operative<br />
Aufgabenwahrnehmung hin ausgerichtet und durch<br />
detaillierte Rechtsgrundlagen angeleitet ist, und den grundsätzlich<br />
verdeckt arbeitenden Nachrichtendiensten, die auf<br />
die Beobachtung und Aufklärung im Vorfeld zur politischen<br />
Information und Beratung beschränkt sind und<br />
sich deswegen auf weniger ausdifferenzierte Rechtsgrundlagen<br />
stützen können. Eine Geheimpolizei ist nicht<br />
vorgesehen.“ 850<br />
Zum Informationsaustausch zwischen Polizei und Nachrichtendiensten<br />
führt das Bundesverfassungsgericht aus:<br />
„Regelungen, die den Austausch von Daten der Polizeibehörden<br />
und Nachrichtendiensten ermöglichen, unterliegen<br />
angesichts dieser Unterschiede gesteigerten verfassungsrechtlichen<br />
Anforderungen. Aus dem Grundrecht auf informationelle<br />
Selbstbestimmung folgt insoweit ein informationelles<br />
Trennungsprinzip. Danach dürfen Daten zwischen<br />
den Nachrichtendiensten und Polizeibehörden grundsätzlich<br />
nicht ausgetauscht werden. Einschränkungen der Datentrennung<br />
sind nur ausnahmsweise zulässig. Soweit sie zur operativen<br />
Aufgabenwahrnehmung erfolgen, begründen sie einen<br />
besonders schweren Eingriff. Der Austausch von Daten zwischen<br />
den Nachrichtendiensten und Polizeibehörden für ein<br />
mögliches operatives Tätigwerden muss deshalb grundsätzlich<br />
einem herausragenden öffentlichen Interesse dienen,<br />
das den Zugriff auf Informationen unter den erleichterten<br />
Bedingungen, wie sie den Nachrichtendiensten zu Gebot<br />
stehen, rechtfertigt. Dies muss durch hinreichend konkrete<br />
849 Akte Nr. 8/BY-4/3_Anlagen/ 1 Aktenordner des PP Mittelfranken zu<br />
BY-4., Bl. 00318.<br />
850 BVerfG vom 28.01.1998, BVerfGE 97, S. 198, 217.