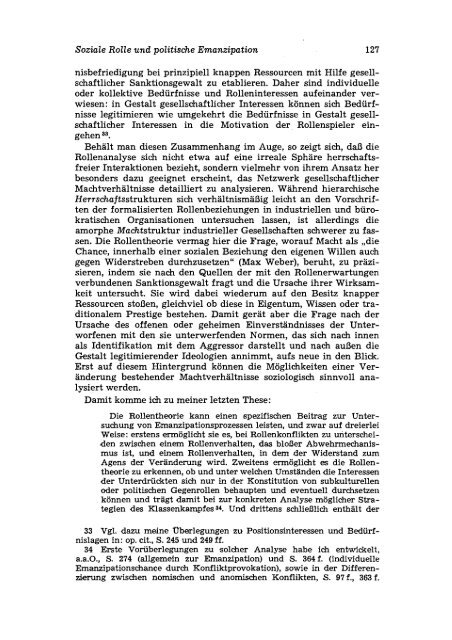Das Argument 71 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 71 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 71 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Soziale Rolle und politische Emanzipation 127<br />
nisbefriedigung bei prinzipiell knappen Ressourcen mit Hilfe gesellschaftlicher<br />
Sanktionsgewalt zu etablieren. Daher sind individuelle<br />
oder kollektive Bedürfnisse und Rolleninteressen aufeinander verwiesen:<br />
in Gestalt gesellschaftlicher Interessen können sich Bedürfnisse<br />
legitimieren wie umgekehrt die Bedürfnisse in Gestalt gesellschaftlicher<br />
Interessen in die Motivation der Rollenspieler eingehen<br />
8S .<br />
Behält man diesen Zusammenhang im Auge, so zeigt sich, daß die<br />
Rollenanalyse sich nicht etwa auf eine irreale Sphäre herrschaftsfreier<br />
Interaktionen bezieht, sondern vielmehr von ihrem Ansatz her<br />
besonders dazu geeignet erscheint, das Netzwerk gesellschaftlicher<br />
Machtverhältnisse detailliert zu analysieren. Während hierarchische<br />
Herrscha/tsstrukturen sich verhältnismäßig leicht an den Vorschriften<br />
der formalisierten Rollenbeziehungen in industriellen und bürokratischen<br />
Organisationen untersuchen lassen, ist allerdings die<br />
amorphe Machtstruktur industrieller Gesellschaften schwerer zu fassen.<br />
Die Rollentheorie vermag hier die Frage, worauf Macht als „die<br />
Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch<br />
gegen Widerstreben durchzusetzen" (Max Weber), beruht, zu präzisieren,<br />
indem sie nach den Quellen der mit den Rollenerwartungen<br />
verbundenen Sanktionsgewalt fragt und die Ursache ihrer Wirksamkeit<br />
untersucht. Sie wird dabei wiederum auf den Besitz knapper<br />
Ressourcen stoßen, gleichviel ob diese in Eigentum, Wissen oder traditionalem<br />
Prestige bestehen. Damit gerät aber die Frage nach der<br />
Ursache des offenen oder geheimen Einverständnisses der Unterworfenen<br />
mit den sie unterwerfenden Normen, das sich nach innen<br />
als Identifikation mit dem Aggressor darstellt und nach außen die<br />
Gestalt legitimierender Ideologien annimmt, aufs neue in den Blick.<br />
Erst auf diesem Hintergrund können die Möglichkeiten einer Veränderung<br />
bestehender Machtverhältnisse soziologisch sinnvoll analysiert<br />
werden.<br />
Damit komme ich zu meiner letzten These:<br />
Die Rollentheorie kann einen spezifischen Beitrag zur Untersuchung<br />
von Emanzipationsprozessen leisten, und ZWEIT auf dreierlei<br />
Weise: erstens ermöglicht sie es, bei Rollenkonflikten zu unterscheiden<br />
zwischen einem Rollenverhalten, das bloßer Abwehrmechanismus<br />
ist, und einem Rollenverhalten, in dem der Widerstand zum<br />
Agens der Veränderung wird. Zweitens ermöglicht es die Rollentheorie<br />
zu erkennen, ob und unter welchen Umständen die Interessen<br />
der Unterdrückten sich nur in der Konstitution von subkulturellen<br />
oder politischen Gegenrollen behaupten und eventuell durchsetzen<br />
können und trägt damit bei zur konkreten Analyse möglicher Strategien<br />
des Klassenkampfes 34 . Und drittens schließlich enthält der<br />
33 Vgl. dazu meine Überlegungen zu Positionsinteressen und Bedürfnislagen<br />
in: op. cit., S. 245 und 249 ff.<br />
34 Erste Vorüberlegungen zu solcher Analyse habe ich entwickelt,<br />
a.a.O., S. 274 (allgemein zur Emanzipation) und S. 364 f. (individuelle<br />
Emanzipationschance durch Konfliktprovokation), sowie in der Differenzierung<br />
zwischen nomischen und anomischen Konflikten, S. 97 f., 363 f.