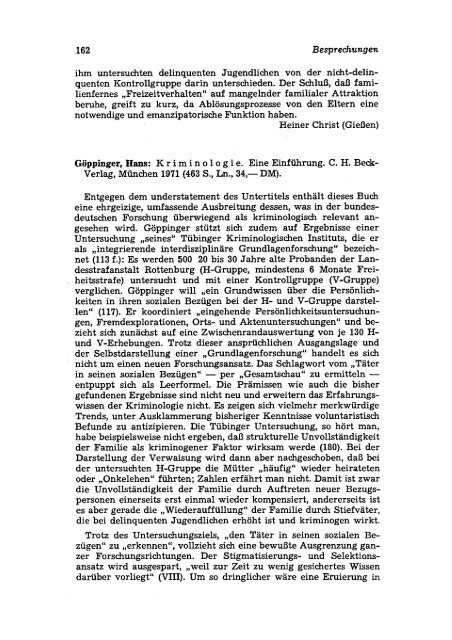Das Argument 71 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 71 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Das Argument 71 - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
162<br />
Besprechungen<br />
ihm untersuchten delinquenten Jugendlichen von der nicht-delinquenten<br />
Kontrollgruppe darin unterschieden. Der Schluß, daß familienfernes<br />
„Freizeitverhalten" auf mangelnder familialer Attraktion<br />
beruhe, greift zu kurz, da Ablösungsprozesse von den Eltern eine<br />
notwendige und emanzipatorische Funktion haben.<br />
Heiner Christ (Gießen)<br />
Göppinger, Hans: K r i m i n o l o g i e . Eine Einführung. C. H. Beck-<br />
Verlag, München 19<strong>71</strong> (463 S., Ln., 34,— DM).<br />
Entgegen dem understatement des Untertitels enthält dieses Buch<br />
eine ehrgeizige, umfassende Ausbreitung dessen, was in der bundesdeutschen<br />
Forschung überwiegend als kriminologisch relevant angesehen<br />
wird. Göppinger stützt sich zudem auf Ergebnisse einer<br />
Untersuchung „seines" Tübinger Kriminologischen <strong>Institut</strong>s, die er<br />
als „integrierende interdisziplinäre Grundlagenforschung" bezeichnet<br />
(113 f.): Es werden 500 20 bis 30 Jahre alte Probanden der Landesstrafanstalt<br />
Rottenburg (H-Gruppe, mindestens 6 Monate Freiheitsstrafe)<br />
untersucht und mit einer Kontrollgruppe (V-Gruppe)<br />
verglichen. Göppinger will „ein Grundwissen über die Persönlichkeiten<br />
in ihren sozialen Bezügen bei der H- und V-Gruppe darstellen"<br />
(117). Er koordiniert „eingehende Persönlichkeitsuntersuchungen,<br />
Fremdexplorationen, Orts- und Aktenuntersuchungen" und bezieht<br />
sich zunächst auf eine Zwischenrandauswertung von je 130 Hund<br />
V-Erhebungen. Trotz dieser ansprüchlichen Ausgangslage und<br />
der Selbstdarstellung einer „Grundlagenforschung" handelt es sich<br />
nicht um einen neuen Forschungsansatz. <strong>Das</strong> Schlagwort vom „Täter<br />
in seinen sozialen Bezügen" — per „Gesamtschau" zu ermitteln —<br />
entpuppt sich als Leerformel. Die Prämissen wie auch die bisher<br />
gefundenen Ergebnisse sind nicht neu und erweitern das Erfahrungswissen<br />
der Kriminologie nicht. Es zeigen sich vielmehr merkwürdige<br />
Trends, unter Ausklammerung bisheriger Kenntnisse voluntaristisch<br />
Befunde zu antizipieren. Die Tübinger Untersuchung, so hört man,<br />
habe beispielsweise nicht ergeben, daß strukturelle Unvollständigkeit<br />
der Familie als kriminogener Faktor wirksam werde (180). Bei der<br />
Darstellung der Verwaisung wird dann aber nachgeschoben, daß bei<br />
der untersuchten H-Gruppe die Mütter „häufig" wieder heirateten<br />
oder „Onkelehen" führten; Zahlen erfährt man nicht. Damit ist zwar<br />
die Unvollständigkeit der Familie durch Auftreten neuer Bezugspersonen<br />
einerseits erst einmal wieder kompensiert, andererseits ist<br />
es aber gerade die „Wiederauffüllung" der Familie durch Stiefväter,<br />
die bei delinquenten Jugendlidien erhöht ist und kriminogen wirkt.<br />
Trotz des Untersuchungsziels, „den Täter in seinen sozialen Bezügen"<br />
zu „erkennen", vollzieht sich eine bewußte Ausgrenzung ganzer<br />
Forschungsrichtungen. Der Stigmatisierungs- und Selektionsansatz<br />
wird ausgespart, „weil zur Zeit zu wenig gesichertes Wissen<br />
darüber vorliegt" (VIII). Um so dringlicher wäre eine Eruierung in