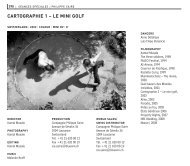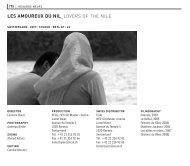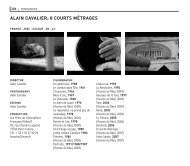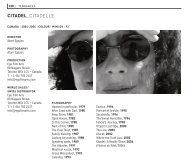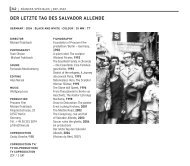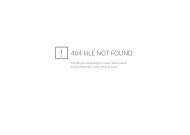Katalog 2013.pdf - Visions du Réel
Katalog 2013.pdf - Visions du Réel
Katalog 2013.pdf - Visions du Réel
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
168 atelier – laila pakalnina<br />
Eine Sache<br />
der Atmosphäre<br />
Das Kino von Laila Pakalnina<br />
«Dieser Film wurde gemacht,<br />
um sich darüber zu freuen,<br />
dass es das Kino gibt.<br />
Gäbe es das Kino nicht,<br />
müsste ich Eisverkäuferin<br />
werden (das war mein<br />
erster Traumberuf).<br />
Aber Kino ist besser als<br />
Eiscreme!»<br />
Stellungnahme der<br />
Regisseurin in «Picas», 2012<br />
Laila Pakalnina ist keine rationelle Filmemacherin.<br />
In dieser wohlüberlegten<br />
Inkohärenz hat sie als Pro<strong>du</strong>zentin<br />
und Regisseurin mehr als zwanzig Filme<br />
geschaffen. «Ein Film ist ein Film», so<br />
ihre Worte wobei unerheblich ist, ob<br />
es sich um einen Kurzfilm oder einen<br />
mittellangen Film, einen Spielfilm, eine<br />
Doku oder eine Fiktion handelt: Die<br />
Vorgehensweise und die Pro<strong>du</strong>ktionsmethoden<br />
mögen sich unterscheiden,<br />
nicht so die Haltung, die trotz einer kontinuierlichen<br />
Evolution alle ihre Filme<br />
<strong>du</strong>rchdringt.<br />
Ihre ersten Arbeiten, besonders die Trilogie<br />
Vela (The Linen, 1991), Pramis (The<br />
Ferry, 1994) und Pasts (The Mail, 1995),<br />
enthalten bereits einige der Eigenarten<br />
und besonderen Merkmale ihrer späteren<br />
Filme. Vela ist ihre Abschlussarbeit<br />
vom VGIK, dem renommierten<br />
staatlichen Filminstitut in Moskau, wo<br />
sie den Filmemacher Gints Berzins<br />
kennenlernte, der ab diesen Filmen<br />
regelmässig ihr Kameramann war<br />
und massgeblich zur Entstehung von<br />
Pakalninas charakteristischem Bildstil<br />
beigetragen hat. Die drei Filme<br />
haben Alltagsroutinen fast könnte<br />
man sagen, nichts Besonderes zum<br />
Thema. Das Aussergewöhnliche dieser<br />
drei Schwarzweissfilme ist die geringe<br />
Bedeutung der Sprache und die maximale<br />
Relevanz kleiner Gesten, die Verwen<strong>du</strong>ng<br />
von Ton, die extrem stil- und<br />
bedeutungsvollen Bildeinstellungen und<br />
natürlich die Atmosphäre, die vielleicht<br />
sogar das wichtigste Konzept in der filmischen<br />
Denkweise der Regisseurin<br />
ist. Bereits in diesen drei Filmen ist eine<br />
zugleich komplexe und extrem zugängliche<br />
Welt erkennbar, eine einzigartige<br />
Mischung aus Leichtigkeit, Empathie,<br />
Aufmerksamkeit und Tiefe, die der oft<br />
problematischen Realität Pakalninas<br />
etwas <strong>du</strong>rch und <strong>du</strong>rch Poetisches verleiht.<br />
Auf einer anderen Ebene ist ein<br />
weiteres wiederkehrendes Element<br />
der Filme Pakalninas zu erkennen: ihr<br />
Heimatland. Doms (The Dome) wurde<br />
1991 gedreht; im gleichen Jahr entstand<br />
mit Vela einer ihrer vermutlich wildesten<br />
Filme. Sie filmt, wie Rigas grösste<br />
Kirche zu einem Unterschlupf für die<br />
Menschen wird, die sich während der<br />
Strassenkämpfe für die Unabhängigkeit<br />
eingesetzt haben. Pakalnina legt<br />
eine direktere soziale und politische<br />
Herangehensweise an den Tag, die sie<br />
später als Verfasserin von Leitartikeln<br />
für die Diena, die wichtigste lettische<br />
Tageszeitung, weiter entwickeln wird.<br />
Der von der Trilogie und Doms sowie<br />
allen Arbeiten von Anfang bis Mitte der<br />
1990er-Jahre gebildete Korpus kann<br />
ebenfalls als eine sehr persönliche<br />
und einzigartige Dokumentation des<br />
Übergangs von einem Lettland unter<br />
sowjetischer Besatzung zu einem unabhängigen<br />
Lettland betrachtet werden.<br />
In Ozols (The Oak, 1997) ist ein offenkundigerer,<br />
auf langen Panorama-<br />
Aufnahmen und frontalen, fast<br />
«schwebenden» Präsentationen ihrer<br />
Figuren beruhender Formenapparat zu<br />
beobachten, der später sowohl in Fiktionen<br />
als auch Dokumentarfilmen Anwen<strong>du</strong>ng<br />
finden wird. Wir finden hier auch<br />
ein ausgeprägtes Gespür für die Natur<br />
– und den Menschen als Teil davon –<br />
das ein charakteristisches Merkmal von<br />
Pakalninas poetischem Universum sein<br />
wird. Kurpe (The Shoe, 1998), ihr erster<br />
Spielfilm, der in die Selektion der Filmfestspiele<br />
von Cannes aufgenommen<br />
wurde, und Pitons (The Python, 2003),<br />
ihr zweiter Spielfilm, auf den Filmfestspielen<br />
von Venedig gezeigt, sind eng<br />
miteinander verbunden und bauen die<br />
bereits sehr reiche stilistische und emotionale<br />
Palette ihrer Filmografie weiter<br />
aus. In beiden Filmen übernimmt Pakalnina<br />
die Idee einer (zwecklosen) Suche:<br />
Mit einem ebenso feinen wie scharfen<br />
Sinn für Humor inszeniert sie gesellschaftskritische<br />
«absurde Dramen», die<br />
oft den Verweis auf Jacques Tati nach<br />
sich ziehen. Die minutiös geplanten<br />
Einstellungen lassen die Handlung wie<br />
zufällig aus dem Bild laufen und fangen<br />
in Ton und Bild Fragmente ein, die keineswegs<br />
nur dekorativ sind, sondern<br />
die Erzählung häufig «leiten». In Sachen<br />
Definition ihres Stils ist Tonmeister<br />
Anrjis Krenbergs, der an den meisten