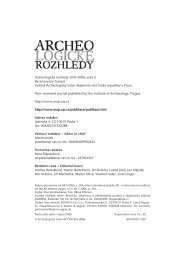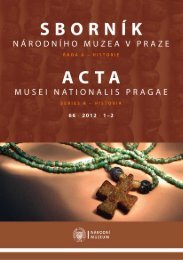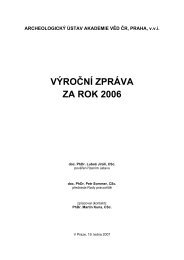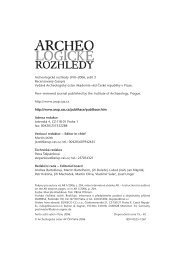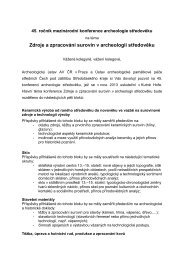Archeologické rozhledy 2004 - Archeologický ústav AV ČR
Archeologické rozhledy 2004 - Archeologický ústav AV ČR
Archeologické rozhledy 2004 - Archeologický ústav AV ČR
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
168<br />
UNGER: In solio sub arcu ...<br />
Popovič, V. 1973/1974: Le tombeau et ľéglise cathédrale de „Méthode“ á Mučavanska Mitrovica, Starinar<br />
24/25, 265–270.<br />
Rettner, A. 1998: Pilger ins Jenseits: Zu den Trägern frühmittelalterlicher Bein- und Reliquiarschnallen, Beiträge<br />
zur Mittelalterarchäologie in Österreich 14, 65–76.<br />
Snášil, R. 2001: Grad Morava. In: L. Galuška – P. Kouřil – Z. Měřínský edd., Velká Morava mezi Východem<br />
a Západem, Brno, 355–364.<br />
Soukupová, H. 1989: Anežský klášter v Praze. Praha.<br />
Staňa, Č. 1996: Hledáme hrob sv. Metoděje, Sborník velehradský 1996, 5–23.<br />
Špičák, Z. 2000: Úvaha k problematice jižní zdi apsidy kostela v Uherském Hradišti-Sadech. In: Sborník prací<br />
filozofické fakulty brněnské univerzity M5, Brno, 133–162.<br />
Theune-Grosskopf, B. 1989: Ein frühmittelalterlicher Kirchenbau mit „Gründergrab“ in Cognin (Savoyen),<br />
Archäologisches Korrespondenzblatt 19, 283–296.<br />
Unger, J. 1994: Hrob sv. Metoděje jako politikum, Univerzitní noviny 1/11, 20–22.<br />
— 1998: Otazník nad otazníky. Na okraj prací zabývajících se lokalizací hrobu sv. Metoděje. Vlastivědný<br />
věstník moravský 50/1, 85–88.<br />
Verberk, A. 1948: Das Grabmal des Emundus im kölner Dom und die frühen rheinischen Bogengräber. In:<br />
Der kölner Dom, Köln, 184–194.<br />
Vetters, H. 1958: Das Grab in der Mauer, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 12, 71–75.<br />
Veselý, J. M. s. d.: Hrob a sídlo arcibiskupa Metoděje. Praha.<br />
Wieczorek, A. – Périn, P. – Welck, K. v. – Menghin, W. 1996: Die Franken – Les Francs. Mainz.<br />
In solio sub arcu<br />
Zum Problem des Grabs von Erzbischof St. Metod<br />
Bestandteil der europäischen Kulturtradition sind Gräber unter Arcosolia. Wir kennen sie aus dem<br />
1. Jh. n. Chr. von Jerusalem (Abb. 1). Bereits die frühchristlichen Gräber in den römischen Katakomben<br />
bestanden manchmal aus einem Bogen über dem in einer ausgehöhlten Grube angebrachten Grab<br />
oder über ein Sarkophag. Gräber dieses Typs sind auch aus der römischen Provinz Pannonien bekannt.<br />
Im Zusammenhang mit dem Bau von Kirchen wurden einige Gräber auch direkt in der Wand angebracht.<br />
Es lassen sich zwei Gruppen dieser Gräber unterscheiden: verdeckte (Abb. 2) und sichtbare<br />
Gräber, d.h. Bogengräber (Arkosolen-Gräber). Gräber der zweiten Gruppe wurden auch im 6. und<br />
7. Jh. auf dem Gebiet des heutigen Frankreich und der Schweiz angelegt (Abb. 3) und sind auch von<br />
einer Reihe weiterer Orte bis in das 14. Jh. bekannt (Abb. 4). Es ist auch möglich, dass Karl der Große<br />
in einem Bogengrab in Aachen bestattet worden ist.<br />
Im Zusammenhang mit der Anlage des Grabs von Erzbischof Metod, der 885 verstarb und der<br />
Legende zufolge in der Mauer einer Kirche bestattet wurde, kann auch ein Arcosolen-Grab erwogen<br />
werden. Es scheint also, dass Metods Grab eben diese aus der europäischen Tradition bekannte Gestalt<br />
gehabt haben kann.<br />
Deutsch von Tomáš Mařík<br />
JOSEF UNGER, Katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Vinařská 5, 602 00<br />
Brno; unger@sci.muni.cz