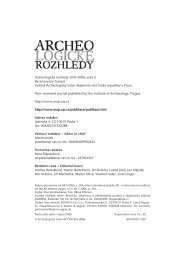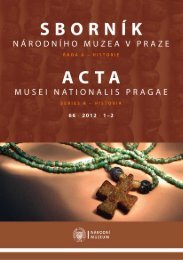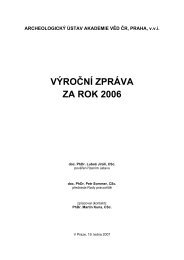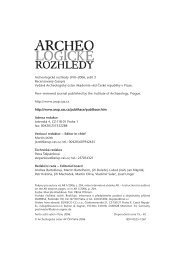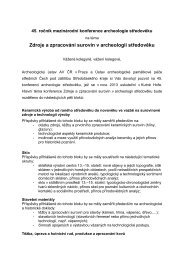Archeologické rozhledy 2004 - Archeologický ústav AV ČR
Archeologické rozhledy 2004 - Archeologický ústav AV ČR
Archeologické rozhledy 2004 - Archeologický ústav AV ČR
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Archeologické</strong> <strong>rozhledy</strong> LVI–<strong>2004</strong> 53<br />
ristisch sind. Die Frage lautet also, wann, wie und über welchen Weg diese beiden fremden Formen<br />
in die Chrudimer Fundkomplexe gelangten.<br />
Auf die Frage „Wann“ liefert die Analyse der Keramik aus den Komplexen von Chrudim und ihr<br />
Vergleich mit datierten Komplexen aus ganz Böhmen eine Antwort, und zwar sind sie durch ihre<br />
Parameter der Wende der Subphasen IVa2 und IVb1 der StK zuzuweisen.<br />
Für das „Wie“ bietet sich als wahrscheinlichste Lösung, dass beide Formen im Zuge des Tauschhandels<br />
zusammen mit hochwertigem Rohstoff zur Herstellung von Spaltindustrie in den böhmischen<br />
Raum gelangten, deren Import von den kleinpolnischen Silex-Lagerstätten des Krakau-Częstochowa-Jura<br />
nach Mähren und Böhmen einwandfrei nachgewiesen ist. Die Analyse des Rohstoffs aus<br />
den Chrudimer Komplexen hat diese Hypothese leider nicht bestätigt. J. Lech (1987) führte in einer<br />
Übersicht des Vorkommens von kleinpolnischen Rohstoffen in Europa sechs Fundorte mit StK aus<br />
Ostböhmen an (Abb. 20), deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch im Land von Chrudim<br />
neben örtlichem Porzellanit und baltischem glazialen Silex verwendet wurde, groß. In Mähren ist<br />
in der Versorgung mit diesem kleinponischem Rohstoff in der älteren Stufe StK eine Zäsur zu beobachten,<br />
d.h. in jenem Zeitraum, in dem wir auch damit rechnen, dass die StK auf polnisches Gebiet<br />
kommt. Zur Wiederbelebung der Beziehungen kommt es erst in der jüngeren Stufe der StK, die vor<br />
allem in Mittel- und Nordmähren vertreten ist und gleichzeitig in der älteren Stufe der MBK (Oliva<br />
1984; Čižmář – Oliva 2001, 122; Kazdová – Peška – Mateiciucová 1999), die beide chronologisch<br />
den Komplexen von Chrudim entsprechen. Deshalb schließen wir, dass der Fund eines Gefäßes mit<br />
ausgebauchtem Kragen mit dem Import von Rohstoff, Halbfabrikaten bzw. Fertigprodukten von den<br />
kleinpolnischen Lagerstätten auf irgendeine Weise zusammenhängen muss. Ob wir es mit unmittelbaren<br />
Kontakten (Tauschhandelsreisen, freundschaftliche Besuche, Geschenke) zu tun haben, oder<br />
ob diese nur vermittelt war, werden kaum je erfahren. Wir wollen aber eine unabhängige Parallelbildung,<br />
d.h. eine unabhängige Anwendung dieses Elements in der Keramikproduktion der böhmischen<br />
StK ausschließen.<br />
Es bleibt die Frage, „auf welchem Wege“ es zum Kontakt zwischen beiden Gebieten gekommen<br />
sein kann. Die Entfernung zwischen Ostböhmen und Kleinpolen beträgt in der Luftlinie ca. 300 km.<br />
Es ist deshalb möglich, dass sich der Kontakt in Etappen abspielte. Von den möglichen Wegen führt<br />
der erste über Nord- und Mittelmähren, entlang des späteren Trstenice-Weges, an dem der Rohstoff<br />
auch erwiesen ist (Abb. 20). Gleichzeitig könnte über diesen Weg auch der bemalte Becher nach Chrudim<br />
gelangt sein. Siedlungsobjekte mit jüngerer StK begleitet von MBK kennen wir sowohl aus dem<br />
Land von Olomouc und Prostějov, als auch neuerdings von Opava. Von dort könnte der Rohstoff weiter<br />
entlang der oberen Morava (Příkazy) in das Land von Mohelnice und Zábřeh, entlang der Mährischen<br />
Sázava nach Svitava und von dort über das Land von Litomyšl und Vysoké Mýto bis nach<br />
Chrudim und weiter nach Mittelböhmen gelangt sein (Vencl 1965, 690; Vích 2001, obr. 2; 2002,<br />
obr. 36; Zápotocký 2002, 480).<br />
Der zweite mögliche Weg führt von Kleinpolen über Schlesien und Glatz in das Land von Hradec<br />
Králové. Trotzdem deutet das Vorkommen beider Gefäße in den Fundkomplexen aus Chrudim eher<br />
auf den südlicheren Weg über Mähren. Die Entwicklung des Neolithikums verlief in Unterschlesien<br />
entsprechend der in Ostböhmen, wo weder die Gruppe Sandomierz-Opatów vertreten ist, noch Formen<br />
mit ausgebauchtem Kragen vorkommen. Zweifellos bestand eine Verbindung über Glatz nach Böhmen,<br />
die von Funden von geschliffener Steinindustrie (Kalferst 1994; Tůma 2002) und von bayerischem<br />
Plattensilex in Schlesien angedeutet wird (Lech 1983, fig. 28.2), kaum wird jedoch der Transport des<br />
Rohstoffs von den kleinpolnischen Lagerstätten nach Böhmen auf diesem Wege erfolgt sein.<br />
Der Reichtum an Funden des kleinpolnischen Rohstoffs zur Zeit der LnK zeugt davon, dass die<br />
Kontakte zwischen Kleinpolen, Mähren und Böhmen relativ intensiv waren und die Entwicklung<br />
beider Gebiete von der ältesten bis zur jüngsten Šárka-Stufe identisch verlief, in Kleinpolen und im<br />
Ostteil Mährens zudem bereichert um Želiezovce-Elemente. Danach scheint es hier, ähnlich wie in<br />
Ostböhmen, Österreich, Schlesien und an der Saale, zu einer Unterbrechung zu kommen, und wir<br />
treffen erst wieder entwicklungsgeschichtlich fortgeschrittenere StK an, die dem Ende der böhmischen<br />
II.–III. Phase entspricht. Wir gehen jedoch davon aus, dass diese Diskontinuität nur scheinbar