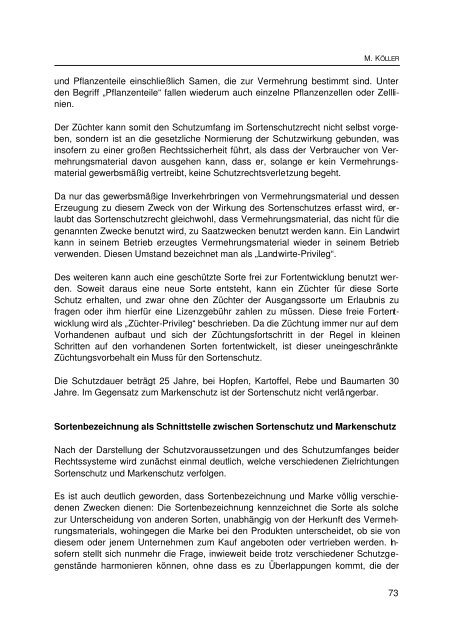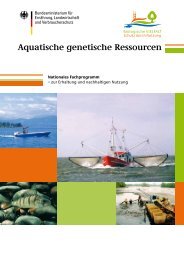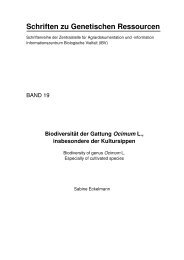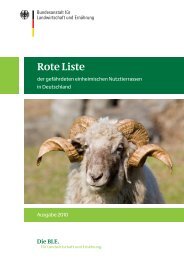Schriften zu Genetischen Ressourcen - Genres
Schriften zu Genetischen Ressourcen - Genres
Schriften zu Genetischen Ressourcen - Genres
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
M. KÖLLER<br />
und Pflanzenteile einschließlich Samen, die <strong>zu</strong>r Vermehrung bestimmt sind. Unter<br />
den Begriff „Pflanzenteile“ fallen wiederum auch einzelne Pflanzenzellen oder Zelllinien.<br />
Der Züchter kann somit den Schut<strong>zu</strong>mfang im Sortenschutzrecht nicht selbst vorgeben,<br />
sondern ist an die gesetzliche Normierung der Schutzwirkung gebunden, was<br />
insofern <strong>zu</strong> einer großen Rechtssicherheit führt, als dass der Verbraucher von Vermehrungsmaterial<br />
davon ausgehen kann, dass er, solange er kein Vermehrungsmaterial<br />
gewerbsmäßig vertreibt, keine Schutzrechtsverlet<strong>zu</strong>ng begeht.<br />
Da nur das gewerbsmäßige Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial und dessen<br />
Erzeugung <strong>zu</strong> diesem Zweck von der Wirkung des Sortenschutzes erfasst wird, erlaubt<br />
das Sortenschutzrecht gleichwohl, dass Vermehrungsmaterial, das nicht für die<br />
genannten Zwecke benutzt wird, <strong>zu</strong> Saatzwecken benutzt werden kann. Ein Landwirt<br />
kann in seinem Betrieb erzeugtes Vermehrungsmaterial wieder in seinem Betrieb<br />
verwenden. Diesen Umstand bezeichnet man als „Landwirte-Privileg“.<br />
Des weiteren kann auch eine geschützte Sorte frei <strong>zu</strong>r Fortentwicklung benutzt werden.<br />
Soweit daraus eine neue Sorte entsteht, kann ein Züchter für diese Sorte<br />
Schutz erhalten, und zwar ohne den Züchter der Ausgangssorte um Erlaubnis <strong>zu</strong><br />
fragen oder ihm hierfür eine Lizenzgebühr zahlen <strong>zu</strong> müssen. Diese freie Fortentwicklung<br />
wird als „Züchter-Privileg“ beschrieben. Da die Züchtung immer nur auf dem<br />
Vorhandenen aufbaut und sich der Züchtungsfortschritt in der Regel in kleinen<br />
Schritten auf den vorhandenen Sorten fortentwickelt, ist dieser uneingeschränkte<br />
Züchtungsvorbehalt ein Muss für den Sortenschutz.<br />
Die Schutzdauer beträgt 25 Jahre, bei Hopfen, Kartoffel, Rebe und Baumarten 30<br />
Jahre. Im Gegensatz <strong>zu</strong>m Markenschutz ist der Sortenschutz nicht verlängerbar.<br />
Sortenbezeichnung als Schnittstelle zwischen Sortenschutz und Markenschutz<br />
Nach der Darstellung der Schutzvorausset<strong>zu</strong>ngen und des Schut<strong>zu</strong>mfanges beider<br />
Rechtssysteme wird <strong>zu</strong>nächst einmal deutlich, welche verschiedenen Zielrichtungen<br />
Sortenschutz und Markenschutz verfolgen.<br />
Es ist auch deutlich geworden, dass Sortenbezeichnung und Marke völlig verschiedenen<br />
Zwecken dienen: Die Sortenbezeichnung kennzeichnet die Sorte als solche<br />
<strong>zu</strong>r Unterscheidung von anderen Sorten, unabhängig von der Herkunft des Vermehrungsmaterials,<br />
wohingegen die Marke bei den Produkten unterscheidet, ob sie von<br />
diesem oder jenem Unternehmen <strong>zu</strong>m Kauf angeboten oder vertrieben werden. Insofern<br />
stellt sich nunmehr die Frage, inwieweit beide trotz verschiedener Schutzgegenstände<br />
harmonieren können, ohne dass es <strong>zu</strong> Überlappungen kommt, die der<br />
73