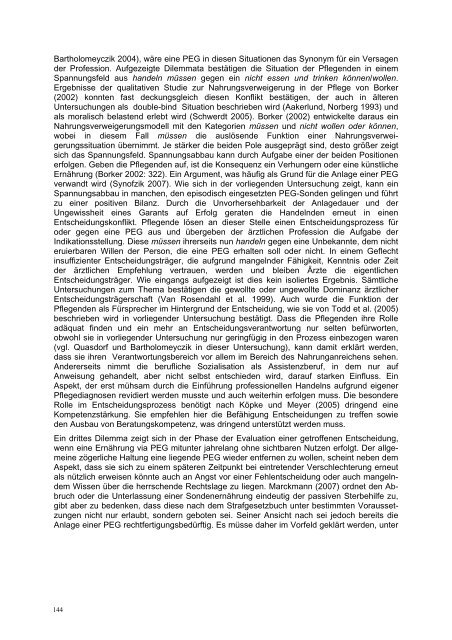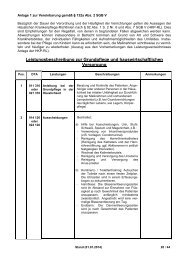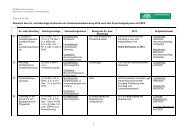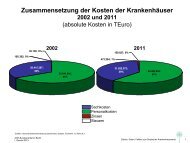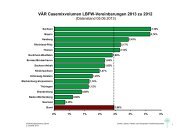Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...
Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...
Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bartholomeyczik 2004), wäre eine PEG in diesen Situationen das Synonym für ein Versagen<br />
<strong>der</strong> Profession. Aufgezeigte Dilemmata bestätigen die Situation <strong>der</strong> Pflegenden in einem<br />
Spannungsfeld aus handeln müssen gegen ein nicht essen und trinken können/wollen.<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> qualitativen Studie <strong>zur</strong> Nahrungsverweigerung in <strong>der</strong> Pflege von Borker<br />
(2002) konnten fast deckungsgleich diesen Konflikt bestätigen, <strong>der</strong> auch in älteren<br />
Untersuchungen als double-bind Situation beschrieben wird (Aakerlund, Norberg 1993) und<br />
als moralisch belastend erlebt wird (Schwerdt 2005). Borker (2002) entwickelte daraus ein<br />
Nahrungsverweigerungsmodell mit den Kategorien müssen und nicht wollen o<strong>der</strong> können,<br />
wobei in diesem Fall müssen die auslösende Funktion <strong>einer</strong> Nahrungsverweigerungssituation<br />
übernimmt. Je stärker die beiden Pole ausgeprägt sind, desto größer zeigt<br />
sich das Spannungsfeld. Spannungsabbau kann durch Aufgabe <strong>einer</strong> <strong>der</strong> beiden Positionen<br />
erfolgen. Geben die Pflegenden auf, ist die Konsequenz ein Verhungern o<strong>der</strong> eine künstliche<br />
Ernährung (Borker 2002: 322). Ein Argument, was häufig als Grund für die <strong>Anlage</strong> <strong>einer</strong> PEG<br />
verwandt wird (Synofzik 2007). Wie sich in <strong>der</strong> vorliegenden Untersuchung zeigt, kann ein<br />
Spannungsabbau in manchen, den episodisch eingesetzten PEG-Sonden gelingen und führt<br />
zu <strong>einer</strong> positiven Bilanz. Durch die Unvorhersehbarkeit <strong>der</strong> <strong>Anlage</strong>dauer und <strong>der</strong><br />
Ungewissheit eines Garants auf Erfolg geraten die Handelnden erneut in einen<br />
<strong>Entscheidungs</strong>konflikt. Pflegende lösen an dieser Stelle einen <strong>Entscheidungs</strong>prozess für<br />
o<strong>der</strong> gegen eine PEG aus und übergeben <strong>der</strong> ärztlichen Profession die Aufgabe <strong>der</strong><br />
Indikationsstellung. Diese müssen ihrerseits nun handeln gegen eine Unbekannte, dem nicht<br />
eruierbaren Willen <strong>der</strong> Person, die eine PEG erhalten soll o<strong>der</strong> nicht. In einem Geflecht<br />
insuffizienter <strong>Entscheidungs</strong>träger, die aufgrund mangeln<strong>der</strong> Fähigkeit, Kenntnis o<strong>der</strong> Zeit<br />
<strong>der</strong> ärztlichen Empfehlung vertrauen, werden und bleiben Ärzte die eigentlichen<br />
<strong>Entscheidungs</strong>träger. Wie eingangs aufgezeigt ist dies kein isoliertes Ergebnis. Sämtliche<br />
Untersuchungen zum Thema bestätigen die gewollte o<strong>der</strong> ungewollte Dominanz ärztlicher<br />
<strong>Entscheidungs</strong>trägerschaft (Van Rosendahl et al. 1999). Auch wurde die Funktion <strong>der</strong><br />
Pflegenden als Fürsprecher im Hintergrund <strong>der</strong> Entscheidung, wie sie von Todd et al. (2005)<br />
beschrieben wird in vorliegen<strong>der</strong> Untersuchung bestätigt. Dass die Pflegenden ihre Rolle<br />
adäquat finden und ein mehr an <strong>Entscheidungs</strong>verantwortung nur selten befürworten,<br />
obwohl sie in vorliegen<strong>der</strong> Untersuchung nur geringfügig in den Prozess einbezogen waren<br />
(vgl. Quasdorf und Bartholomeyczik in dieser Untersuchung), kann damit erklärt werden,<br />
dass sie ihren Verantwortungsbereich vor allem im Bereich des Nahrunganreichens sehen.<br />
An<strong>der</strong>erseits nimmt die berufliche Sozialisation als Assistenzberuf, in dem nur auf<br />
Anweisung gehandelt, aber nicht selbst entschieden wird, darauf starken Einfluss. Ein<br />
Aspekt, <strong>der</strong> erst mühsam durch die Einführung professionellen Handelns aufgrund eigener<br />
Pflegediagnosen revidiert werden musste und auch weiterhin erfolgen muss. Die beson<strong>der</strong>e<br />
Rolle im <strong>Entscheidungs</strong>prozess benötigt nach Köpke und Meyer (2005) dringend eine<br />
Kompetenzstärkung. Sie empfehlen hier die Befähigung Entscheidungen zu treffen sowie<br />
den Ausbau von Beratungskompetenz, was dringend unterstützt werden muss.<br />
Ein drittes Dilemma zeigt sich in <strong>der</strong> Phase <strong>der</strong> Evaluation <strong>einer</strong> getroffenen Entscheidung,<br />
wenn eine Ernährung via PEG mitunter jahrelang ohne sichtbaren Nutzen erfolgt. Der allgemeine<br />
zögerliche Haltung eine liegende PEG wie<strong>der</strong> entfernen zu wollen, scheint neben dem<br />
Aspekt, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt bei eintreten<strong>der</strong> Verschlechterung erneut<br />
als nützlich erweisen könnte auch an Angst vor <strong>einer</strong> Fehlentscheidung o<strong>der</strong> auch mangelndem<br />
Wissen über die herrschende Rechtslage zu liegen. Marckmann (2007) ordnet den Abbruch<br />
o<strong>der</strong> die Unterlassung <strong>einer</strong> Sondenernährung eindeutig <strong>der</strong> passiven Sterbehilfe zu,<br />
gibt aber zu bedenken, dass diese nach dem Strafgesetzbuch unter bestimmten Voraussetzungen<br />
nicht nur erlaubt, son<strong>der</strong>n geboten sei. S<strong>einer</strong> Ansicht nach sei jedoch bereits die<br />
<strong>Anlage</strong> <strong>einer</strong> PEG rechtfertigungsbedürftig. Es müsse daher im Vorfeld geklärt werden, unter<br />
144