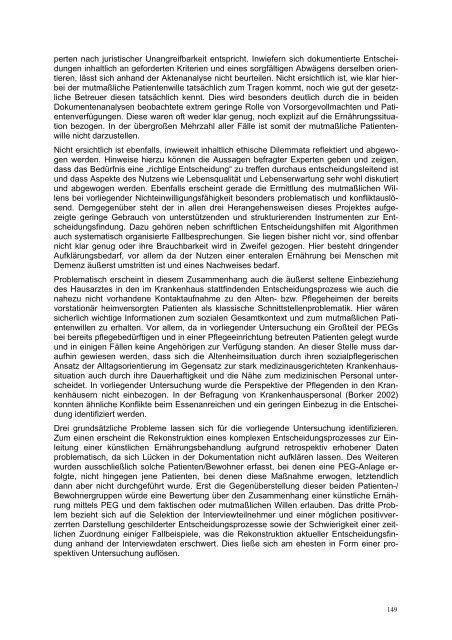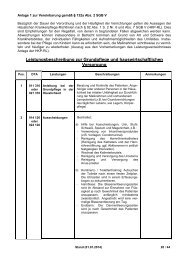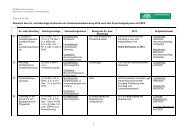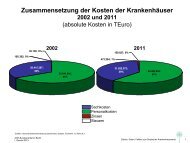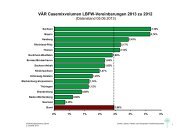Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...
Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...
Ablauf der Entscheidungs- prozesse zur Anlage einer perkutanen ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
perten nach juristischer Unangreifbarkeit entspricht. Inwiefern sich dokumentierte Entscheidungen<br />
inhaltlich an gefor<strong>der</strong>ten Kriterien und eines sorgfältigen Abwägens <strong>der</strong>selben orientieren,<br />
lässt sich anhand <strong>der</strong> Aktenanalyse nicht beurteilen. Nicht ersichtlich ist, wie klar hierbei<br />
<strong>der</strong> mutmaßliche Patientenwille tatsächlich zum Tragen kommt, noch wie gut <strong>der</strong> gesetzliche<br />
Betreuer diesen tatsächlich kennt. Dies wird beson<strong>der</strong>s deutlich durch die in beiden<br />
Dokumentenanalysen beobachtete extrem geringe Rolle von Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen.<br />
Diese waren oft we<strong>der</strong> klar genug, noch explizit auf die Ernährungssituation<br />
bezogen. In <strong>der</strong> übergroßen Mehrzahl aller Fälle ist somit <strong>der</strong> mutmaßliche Patientenwille<br />
nicht darzustellen.<br />
Nicht ersichtlich ist ebenfalls, inwieweit inhaltlich ethische Dilemmata reflektiert und abgewogen<br />
werden. Hinweise hierzu können die Aussagen befragter Experten geben und zeigen,<br />
dass das Bedürfnis eine „richtige Entscheidung“ zu treffen durchaus entscheidungsleitend ist<br />
und dass Aspekte des Nutzens wie Lebensqualität und Lebenserwartung sehr wohl diskutiert<br />
und abgewogen werden. Ebenfalls erscheint gerade die Ermittlung des mutmaßlichen Willens<br />
bei vorliegen<strong>der</strong> Nichteinwilligungsfähigkeit beson<strong>der</strong>s problematisch und konfliktauslösend.<br />
Demgegenüber steht <strong>der</strong> in allen drei Herangehensweisen dieses Projektes aufgezeigte<br />
geringe Gebrauch von unterstützenden und strukturierenden Instrumenten <strong>zur</strong> <strong>Entscheidungs</strong>findung.<br />
Dazu gehören neben schriftlichen <strong>Entscheidungs</strong>hilfen mit Algorithmen<br />
auch systematisch organisierte Fallbesprechungen. Sie liegen bisher nicht vor, sind offenbar<br />
nicht klar genug o<strong>der</strong> ihre Brauchbarkeit wird in Zweifel gezogen. Hier besteht dringen<strong>der</strong><br />
Aufklärungsbedarf, vor allem da <strong>der</strong> Nutzen <strong>einer</strong> enteralen Ernährung bei Menschen mit<br />
Demenz äußerst umstritten ist und eines Nachweises bedarf.<br />
Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang auch die äußerst seltene Einbeziehung<br />
des Hausarztes in den im Krankenhaus stattfindenden <strong>Entscheidungs</strong>prozess wie auch die<br />
nahezu nicht vorhandene Kontaktaufnahme zu den Alten- bzw. Pflegeheimen <strong>der</strong> bereits<br />
vorstationär heimversorgten Patienten als klassische Schnittstellenproblematik. Hier wären<br />
sicherlich wichtige Informationen zum sozialen Gesamtkontext und zum mutmaßlichen Patientenwillen<br />
zu erhalten. Vor allem, da in vorliegen<strong>der</strong> Untersuchung ein Großteil <strong>der</strong> PEGs<br />
bei bereits pflegebedürftigen und in <strong>einer</strong> Pflegeeinrichtung betreuten Patienten gelegt wurde<br />
und in einigen Fällen keine Angehörigen <strong>zur</strong> Verfügung standen. An dieser Stelle muss daraufhin<br />
gewiesen werden, dass sich die Altenheimsituation durch ihren sozialpflegerischen<br />
Ansatz <strong>der</strong> Alltagsorientierung im Gegensatz <strong>zur</strong> stark medizinausgerichteten Krankenhaussituation<br />
auch durch ihre Dauerhaftigkeit und die Nähe zum medizinischen Personal unterscheidet.<br />
In vorliegen<strong>der</strong> Untersuchung wurde die Perspektive <strong>der</strong> Pflegenden in den Krankenhäusern<br />
nicht einbezogen. In <strong>der</strong> Befragung von Krankenhauspersonal (Borker 2002)<br />
konnten ähnliche Konflikte beim Essenanreichen und ein geringen Einbezug in die Entscheidung<br />
identifiziert werden.<br />
Drei grundsätzliche Probleme lassen sich für die vorliegende Untersuchung identifizieren.<br />
Zum einen erscheint die Rekonstruktion eines komplexen <strong>Entscheidungs</strong><strong>prozesse</strong>s <strong>zur</strong> Einleitung<br />
<strong>einer</strong> künstlichen Ernährungsbehandlung aufgrund retrospektiv erhobener Daten<br />
problematisch, da sich Lücken in <strong>der</strong> Dokumentation nicht aufklären lassen. Des Weiteren<br />
wurden ausschließlich solche Patienten/Bewohner erfasst, bei denen eine PEG-<strong>Anlage</strong> erfolgte,<br />
nicht hingegen jene Patienten, bei denen diese Maßnahme erwogen, letztendlich<br />
dann aber nicht durchgeführt wurde. Erst die Gegenüberstellung dieser beiden Patienten-/<br />
Bewohnergruppen würde eine Bewertung über den Zusammenhang <strong>einer</strong> künstliche Ernährung<br />
mittels PEG und dem faktischen o<strong>der</strong> mutmaßlichen Willen erlauben. Das dritte Problem<br />
bezieht sich auf die Selektion <strong>der</strong> Interviewteilnehmer und <strong>einer</strong> möglichen positivverzerrten<br />
Darstellung geschil<strong>der</strong>ter <strong>Entscheidungs</strong><strong>prozesse</strong> sowie <strong>der</strong> Schwierigkeit <strong>einer</strong> zeitlichen<br />
Zuordnung einiger Fallbeispiele, was die Rekonstruktion aktueller <strong>Entscheidungs</strong>findung<br />
anhand <strong>der</strong> Interviewdaten erschwert. Dies ließe sich am ehesten in Form <strong>einer</strong> prospektiven<br />
Untersuchung auflösen.<br />
149