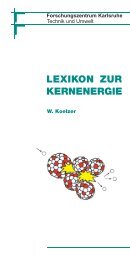H - LAN
H - LAN
H - LAN
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kühlturm<br />
zur Rückkühlung von Wasser, bei dem kein direkter Kontakt zwischen dem zu kühlenden Wasser<br />
und dem Kühlmedium Luft besteht. Das erwärmte Wasser wird, ähnlich wie in einem Kraftfahrzeugkühler,<br />
von Luft gekühlt und wieder zum Kondensator geleitet.<br />
Trockenlager<br />
Lagerung bestrahlter Brennelemente ohne Verwendung von Wasser als Kühlmittel.<br />
Tschernobyl<br />
Am Standort Tschernobyl, 130 km nordwestlich von Kiew, sind zwischen 1977 und 1983 vier Reaktorblöcke<br />
vom Typ RBMK-1000 in Betrieb gegangen. Im Block 4 ereignete sich am 26.4.1986 der bisher schwerste<br />
Unfall bei der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Der Unfall im Kernkraftwerk von Tschernobyl ist zwar<br />
auch auf eine Kette von falschen Entscheidungen und verbotenen Eingriffen der Bedienungsmannschaft<br />
zurückzuführen, letztlich sind aber das unzureichende Reaktorsicherheitskonzept für das Eintreten des Unfalls<br />
und das Fehlen eines druckfesten, die Reaktoranlage umschließenden Sicherheitsbehälters für die<br />
Freisetzung der großen Mengen an radioaktiven Stoffen verantwortlich. Der Reaktorunfall entwickelte sich<br />
während eines Experimentes mit dem Turbinen-Generatorsatz der Kraftwerksanlage. Durch eine ganze Reihe<br />
von Bedienungsfehlern, bis hin zu der Überbrückung von Abschaltsignalen, kam es zu einem starken<br />
Leistungsanstieg - bis zum 100-fachen der Nennleistung. Durch die Überhitzung des Brennstoffes barsten<br />
Brennstabhüllen,<br />
und es kam zu einer heftigen Brennstoff/Wasser-Reaktion mit stoßartigem Druckaufbau<br />
und Zerstörung des Reaktorgebäudes. Große Teile des Graphitmoderators und der Anlage wurden in Brand<br />
gesetzt. Während dieser Zerstörungsphase wurden schätzungsweise acht Tonnen radioaktiven Brennstoffes<br />
aus dem Kern in das Gebäude und die Umgebung geschleudert. Durch die unmittelbar einsetzende Brandbekämpfung<br />
gelang es, die Brände außerhalb des Reaktorgebäudes und am Maschinenhaus in vier Stunden<br />
zu löschen. Um den Brand des Moderatorgraphits im Reaktor zu ersticken und zur Eindämmung der<br />
Unfallfolgen wurde der Block 4 in den folgenden Tagen aus der Luft mit insgesamt 5 000 Tonnen Blei, Sand<br />
und Lehm zugeschüttet. Bis November 1986 wurde der Reaktorblock Tschernobyl 4 unter einer Struktur aus<br />
meterdickem Beton – Sarkophag genannt - „begraben“.<br />
Die massive Freisetzung radioaktiver Spaltprodukte aus dem zerstörten Reaktor erstreckte sich über insgesamt<br />
zehn Tage. Aufgrund der thermischen Auftriebseffekte erfolgte die Freisetzung, insbesondere die der<br />
leichtflüchtigen Spaltprodukte wie Iod und Cäsium, bis in große Höhen (1 500 m und darüber). Dies führte zu<br />
einer Verteilung der in die Atmosphäre freigesetzten Aktivität von 4 10 18 Bq über weite Teile Europas. Die<br />
am 26. April freigesetzten radioaktiven Stoffe gelangten aufgrund der vorherrschenden Windrichtung nach<br />
Nordwesten und erreichten am 28. April Schweden. Der dort gemessene Aktivitätsanstieg der Luft war im<br />
Westen der erste Hinweis auf den Unfall. Aufgrund der Wetterverhältnisse gelangte die Aktivitätsemission<br />
des 27. April über Polen und die vom 29. und 30. April über den Balkan nach Mitteleuropa. Am 29. April erreichte<br />
die radioaktive Wolke das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Das Kraftwerkspersonal und insbesondere das zur Brandbekämpfung eingesetzte Personal waren sehr stark<br />
von der Strahlung betroffen. Die Dosiswerte betrugen bis zu 16 Gy. 203 Personen mit akutem Strahlensyndrom<br />
wurden in Kliniken behandelt. 31 Personen starben infolge Verbrennungen und Strahlenüberexposition.<br />
Die Strahlenexposition in der 4 km westlich vom Standort gelegenen Stadt Pripyat mit 45 000 Einwohnern<br />
erreichte am Tag nach dem Unfall bis zu 6 mSv/h. Die Bevölkerung wurde daraufhin evakuiert. In den<br />
nächsten Tagen wurden dann weitere 90 000 Personen aus der 30-km-Zone um den Standort evakuiert.<br />
Eine Wiederbesiedlung der 10-km-Zone ist nicht beabsichtigt, die landwirtschaftliche Nutzung der 10- bis 30km-Zone<br />
wird vom Erfolg von Dekontaminationsprogrammen und dem Ergebnis radiologischer Untersuchungen<br />
abhängig gemacht.<br />
Durch meteorologische Einflüsse bedingt sind die aus der radioaktiven Wolke abgelagerten Aktivitätsmengen<br />
in den Regionen der Bundesrepublik sehr unterschiedlich - im Norden und Westen deutlich geringer als<br />
im Süden und Südosten. Daher ist keine bundeseinheitliche Darstellung hinsichtlich der resultierenden<br />
Strahlendosis, die zudem noch stark von der individuellen Ernährungsgewohnheit abhängt, möglich. Die<br />
Inhalationsdosis wurde fast ausschließlich durch die Luftaktivität in der Zeit vom 1. bis 5. Mai 1986 bestimmt.<br />
Die Ingestionsdosis ergibt sich fast ausschließlich durch I-131, Cs-134 und Cs-137. Die Strahlenexposition in<br />
den Folgejahren ist wesentlich geringer als im ersten Jahr nach dem Unfall, da die Effekte der Oberflächenkontamination,<br />
die direkt (z. B. über Gemüse) oder indirekt (z. B. über Milch und Fleisch) zur Strahlenexposition<br />
beitrugen, entfallen. Die Strahlenexposition in Deutschland betrug für Kleinkinder, für die sich gegenüber<br />
Erwachsenen generell höhere Dosiswerte errechnen, für das Jahr des Unfalls zwischen 0,1 mSv in Gebieten<br />
nördlich der Donau und 0,6 mSv für Bereiche des Voralpengebiets. Berechnet man die entsprechenden<br />
Dosiswerte für die gesamte Lebenszeit, so ergibt sich ein Gesamtbetrag zwischen 0,4 mSv bzw. 2,4 mSv für<br />
die Personengruppe, die zum Unfallzeitpunkt Kleinkinder waren. Für Einzelpersonen mit extremen Lebens-<br />
165