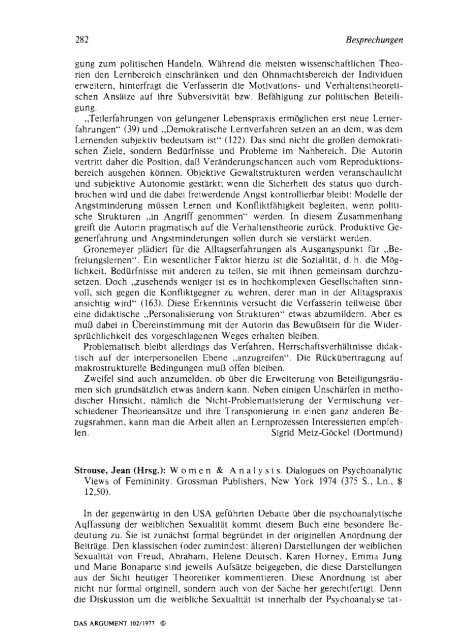Sozialismus-Diskussion - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sozialismus-Diskussion - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sozialismus-Diskussion - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
282 Besprechungen<br />
gung zum politischen Handeln. Während die meisten wissenschaftlichen <strong>Theorie</strong>n<br />
den Lernbereich einschränken und den Ohnmachtsbereich der Individuen<br />
erweitern, hinterfragt die Verfasserin die Motivations- und Verhaltenstheoretischen<br />
Ansätze auf ihre Subversivität bzw. Befähigung zur politischen Beteiligung.<br />
"Teilerfahrungen von gelungener Lebenspraxis ermöglichen erst neue Lernerfahrungen"<br />
(39) und "Demokratische Lernverfahren setzen an an dem, was dem<br />
Lernenden subjektiv bedeutsam ist" (122). Das sind nicht die großen demokratischen<br />
Ziele, sondern Bedürfnisse und Probleme im Nahbereich. Die Autorin<br />
vertritt daher die Position, daß Veränderungschancen auch vom Reproduktionsbereich<br />
ausgehen können. Objektive Gewaltstrukturen werden veranschaulicht<br />
und subjektive Autonomie gestärkt; wenn die Sicherheit des status quo durchbrochen<br />
wird und die dabei freiwerdende Angst kontrollierbar bleibt: Modelle der<br />
Angstminderung müssen Lernen und Konfliktfähigkeit begleiten, wenn politische<br />
Strukturen "in Angriff genommen" werden. In diesem Zusammenhang<br />
greift die Autorin pragmatisch auf die Verhaltenstheorie zurück. Produktive Gegenerfahrung<br />
und Angstminderungen sollen durch sie verstärkt werden.<br />
Gronemeyer plädiert für die Alltagserfahrungen als Ausgangspunkt für "Befreiungslernen".<br />
Ein wesentlicher Faktor hierzu ist die Sozialität, d. h. die Möglichkeit,<br />
Bedürfnisse mit anderen zu teilen, sie mit ihnen gemeinsam durchzusetzen.<br />
Doch "zusehends weniger ist es in hochkomplexen Gesellschaften sinnvoll,<br />
sich gegen die Konfliktgegner zu wehren, derer man in der Alltagspraxis<br />
ansichtig wird" (163). Diese Erkenntnis versucht die Verfasserin teilweise über<br />
eine didaktische "Personalisierung von Strukturen" etwas abzumildern. Aber es<br />
muß dabei in Übereinstimmung mit der Autorin das Bewußtsein für die Widersprüchlichkeit<br />
des vorgeschlagenen Weges erhalten bleiben.<br />
Problematisch bleibt allerdings das Verfahren, Herrschaftsverhältnisse didaktisch<br />
auf der interpersonellen Ebene "anzugreifen". Die Rückübertragung auf<br />
makrostrukturelle Bedingungen muß offen bleiben.<br />
Zweifel sind auch anzumelden, ob über die Erweiterung von Beteiligungsräumen<br />
sich grundsätzlich etwas ändern kann. Neben einigen Unschärfen in methodischer<br />
Hinsicht, nämlich die Nicht-Problematisierung der Vermischung verschiedener<br />
<strong>Theorie</strong>ansätze und ihre Transponierung in einen ganz anderen Bezugsrahmen,<br />
kann man die Arbeit allen an Lernprozessen Interessierten empfeh-<br />
1en.<br />
Sigrid Metz-Göckel (Dortmund)<br />
Strouse, Jean (Hrsg.): Wo m e n & An a I y s i s. Dialogues on Psychoanalytic<br />
Views of Femininity. Grossman Publishers, New York 1974 (375 S., Ln., $<br />
12,50).<br />
In der gegenwärtig in den USA geführten Debatte über die psychoanalytische<br />
Allffassung der weiblichen Sexualität kommt diesem Buch eine besondere Bedeutung<br />
zu. Sie ist zunächst formal begründet in der originellen Anordnung der<br />
Beiträge. Den klassischen (oder zumindest: älteren) Darstellungen der weiblichen<br />
Sexualität von Freud, Abraham, Helene Deutsch, Karen Horney, Emma Jung<br />
und Marie Bonaparte sind jeweils Aufsätze beigegeben, die diese Darstellungen<br />
aus der Sicht heutiger Theoretiker kommentieren. Diese Anordnung ist aber<br />
nicht nur formal originell, sondern auch von der Sache her gerechtfertigt. Denn<br />
die <strong>Diskussion</strong> um die weibliche Sexualität ist innerhalb der Psychoanalyse tat-<br />
DAS ARGUMENT 102/1977 ©