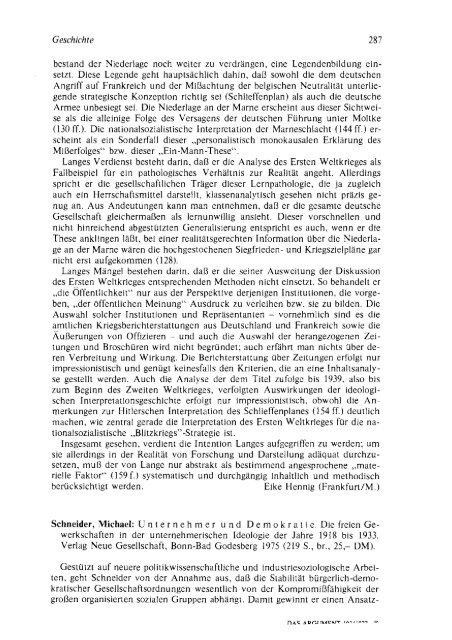Sozialismus-Diskussion - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sozialismus-Diskussion - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Sozialismus-Diskussion - Berliner Institut für kritische Theorie eV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Geschichte 287<br />
bestand der Niederlage noch weiter zu verdrängen, eine Legendenbildung einsetzt.<br />
Diese Legende geht hauptsächlich dahin, daß sowohl die dem deutschen<br />
Angriff auf Frankreich und der Mißachtung der belgisehen Neutralität unterliegende<br />
strategische Konzeption richtig sei (Schlieffenplan) als auch die deutsche<br />
Armee unbesiegt sei. Die Niederlage an der Marne erscheint aus dieser Sichtweise<br />
als die alleinige Folge des Versagens der deutschen Führung unter Moltke<br />
(130 fL). Die nationalsozialistische Interpretation der Marneschlacht (144 ff.) erscheint<br />
als ein Sonderfall dieser "personalistisch monokausalen Erklärung des<br />
Mißerfolges" bzw. dieser "Ein-Mann-These".<br />
Langes Verdienst besteht darin, daß er die Analyse des Ersten Weltkrieges als<br />
Fallbeispiel für ein pathologisches Verhältnis zur Realität angeht. Allerdings<br />
spricht er die gesellschaftlichen Träger dieser Lernpathologie, die ja zugleich<br />
auch ein Herrschaftsmittel darstellt, klassenanalytisch gesehen nicht präzis genug<br />
an. Aus Andeutungen kann man entnehmen, daß er die gesamte deutsche<br />
Gesellschaft gleichermaßen als lernunwillig ansieht. Dieser vorschnellen und<br />
nicht hinreichend abgestützten Generalisierung entspricht es auch, wenn er die<br />
These anklingen läßt, bei einer realitätsgerechten Information über die Niederlage<br />
an der Marne wären die hochgestochenen Siegfrieden- und Kriegszielpläne gar<br />
nicht erst aufgekommen (128).<br />
Langes Mängel bestehen darin, daß er die seiner Ausweitung der <strong>Diskussion</strong><br />
des Ersten Weltkrieges entsprechenden Methoden nicht einsetzt. So behandelt er<br />
"die Öffentlichkeit" nur aus der Perspektive derjenigen <strong>Institut</strong>ionen, die vorgeben,<br />
"der öffentlichen Meinung" Ausdruck zu verleihen bzw. sie zu bilden. Die<br />
Auswahl solcher <strong>Institut</strong>ionen und Repräsentanten - vornehmlich sind es die<br />
amtlichen Kriegsberichterstattungen aus Deutschland und Frankreich sowie die<br />
Äußerungen von Offizieren - und auch die Auswahl der herangezogenen Zeitungen<br />
und Broschüren wird nicht begründet; auch erfährt man nichts über deren<br />
Verbreitung und Wirkung. Die Berichterstattung über Zeitungen erfolgt nur<br />
impressionistisch und genügt keinesfalls den Kriterien, die an eine Inhaltsanalyse<br />
gestellt werden. Auch die Analyse der dem Titel zufolge bis 1939, also bis<br />
zum Beginn des Zweiten Weltkrieges, verfolgten Auswirkungen der ideologischen<br />
Interpretationsgeschichte erfolgt nur impressionistisch, obwohl die Anmerkungen<br />
zur Hitlerschen Interpretation des Schlieffenplanes (154 fL) deutlich<br />
machen, wie zentral gerade die Interpretation des Ersten Weltkrieges für die nationalsozialistische<br />
"Blitzkriegs"-Strategie ist.<br />
Insgesamt gesehen, verdient die Intention Langes aufgegriffen zu werden; um<br />
sie allerdings in der Realität von Forschung und Darstellung adäquat durchzusetzen,<br />
muß der von Lange nur abstrakt als bestimmend angesprochene "materielle<br />
Faktor" (159 f.) systematisch und durchgängig inhaltlich und methodisch<br />
berücksichtigt werden.<br />
Eike Hennig (Frankfurt/M.)<br />
Schneider, Michael: U nt ern e h m er und Dem 0 k rat i e. Die freien Gewerkschaften<br />
in der unternehmerischen Ideologie der Jahre 1918 bis 1933.<br />
Verlag Neue Gesellschaft, Bonn-Bad Godesberg 1975 (219 S., br., 25,- DM).<br />
Gestützt auf neuere politikwissenschaftliche und industriesoziologische Arbeiten,<br />
geht Schneider von der Annahme aus, daß die Stabilität bürgerlich-demokratischer<br />
Gesellschaftsordnungen wesentlich von der Kompromißfähigkeit der<br />
großen organisierten sozialen Gruppen abhängt. Damit gewinnt er einen AnsatznA