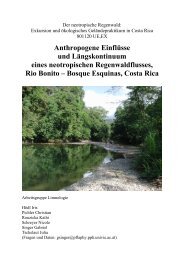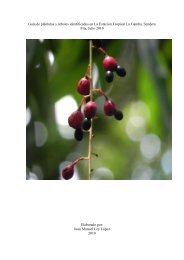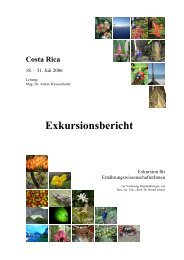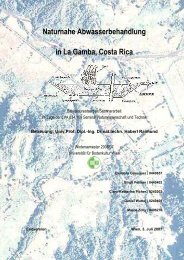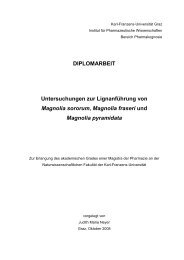Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Barbara Lukasch, Gina Philipp<br />
Reptilien und Amphibien<br />
Nach ihren Lebensraumansprüchen können die Reptilien in drei Gruppen unterschieden werden:<br />
• Die Generalisten sind anspruchslos und sehr weit verbreitet. Sie brauchen nahrungsreiche<br />
Areale und mehrere Stunden Sonne pro Tag, die den Boden erwärmt. Sie meiden geschlossene,<br />
schattige Waldgebiete und unter ihnen finden sich einige Schlangen- und Eidechsenarten.<br />
• Die wasserliebenden Reptilien sind an offene Gewässer gebunden (z.B. die Schnappschildkröte).<br />
Zusätzlich benötigen sie ungestörte Sonnenplätze, vorzugsweise direkt an der Wasserkante.<br />
• Arten der offenen bis halboffenen Trockenstandorte (z.B. der Asiatische Hausgecko) sind<br />
besonders wärmeliebend.<br />
Die meisten Reptilienarten legen Eier, doch einige Arten sind als Anpassung an kühlere klimatische<br />
Bedingungen auch lebendgebärend. Die Entwicklung der Eier erfolgt in diesen Fällen im Mutterleib<br />
und die Jungen schlüpfen dann während der Geburt. Doch normalerweise werden die gelegten Eier in<br />
Erdlöchern oder in verrottendem Substrat abgelegt. Durch die Sonne werden die Eier gewärmt und<br />
„ausgebrütet". Manche Schlangen bilden Paarungsgemeinschaften (ein Schlangenkönig mit Gefolge),<br />
bei den Eidechsen schließen sich Tiere in der Regel für eine Saison zu festen Paaren zusammen.<br />
Die Befruchtung erfolgt ausschließlich im Körper der Weibchen. Viele Reptilienarten beanspruchen<br />
eigene Reviere und kämpfen auch darum. Während Kämpfe unter Schlangen eher durch Imponiergehabe<br />
bestimmt werden, gibt es bei Eidechsen durchaus öfter verletzte Tiere. Bei Gefahr können Eidechsen<br />
ihren Schwanz abwerfen und können so entkommen, während der noch zuckende Schwanz den<br />
Verfolger ablenkt. Dieser wächst aber wieder nach, obwohl er nicht mehr ganz so groß wird.<br />
SCHLANGEN<br />
Schlangen gehören zur Gruppe der „Eigentlichen Schuppenkriechtiere“, auch Squamata genannt.<br />
Ihre Beine sind vollständig zurückgebildet, der Unterkiefer bezahnt und der lang gestreckte Körper ist<br />
mit einem flexiblen Panzer aus Hornschuppen, die dachziegelartig angeordnet sind, bedeckt. Im Zuge<br />
der Häutung streift sich die alte Hornschicht meist im Ganzen ab.<br />
Die meisten Schlangen, aber vor allem die nachtaktiven, lokalisieren sowohl Nahrung als auch die<br />
Partner über Chemorezeption, weswegen der olfaktorischen Wahrnehmung am meisten Bedeutung<br />
zugeschrieben werden kann. Neben der Geruchswahrnehmung über die Nasenlöcher besitzen Schlangen,<br />
wie auch einige andere Wirbeltiere, das Jacobson-Organ, welches auch als Vomeronasales Organ<br />
bezeichnet wird. Dabei handelt es sich um kleine Einbuchtungen (0,2 – 2mm) auf beiden Seiten<br />
der Nasenscheidenwand. Das Wahrnehmen mit diesem Organ wird Flehmen genannt, worunter man<br />
das gezielte – und am geöffneten Maul und der Haltung erkennbare – Wittern nach spezifischen Gerüchen<br />
versteht. So öffnen z.B. Katzen das Maul ein wenig und strecken die Zungenspitze heraus. Beim<br />
Einatmen werden dann Geruchsstoffe am Gaumen entlang geleitet und können sowohl gerochen wie<br />
auch geschmeckt werden. Schlangen nehmen mit Hilfe der gespaltenen Zunge Duftpartikel aus der<br />
Umgebung auf und befördern sie zum Riechorgan. Auf diese Weise spüren sie ihre Beute auf, finden<br />
Überwinterungsquartiere und Paarungspartner.<br />
Dafür ist die auditive Wahrnehmung reduziert. Schlangen besitzen keine Ohren und für Geräusche, die<br />
durch die Luft übertragen werden, sind sie taub. Eine Klapperschlange hört also das Rasseln einer<br />
anderen nicht und genauso wenig hört eine Kobra die Flöte eines Schlangenbeschwörers. Über ihre<br />
Kieferknochen können sie aber schon geringste Erschütterungen des Untergrundes wahrnehmen, wenn<br />
sie ihren Kopf auf den Boden legen.<br />
Der Gesichtssinn wiederum ist bei den meisten Schlangen sehr gut ausgebildet. Lediglich einige grabende<br />
Schlangen sind praktisch blind.<br />
Auch ohne Beine können sich Schlangen rasch fortbewegen, was durch vier recht unterschiedliche<br />
Methoden erfolgt. Am häufigsten kriechen sie wellenförmig, was als Schlängeln bezeichnet wird.<br />
Hierbei stößt sich die Schlange an der Hinterseite jeder Kurve oder Wellenbewegung vom Untergrund<br />
ab und gleitet geschmeidig vorwärts. Eine zweite Form, die als raupenartige Fortbewegung beschrieben<br />
werden kann, wird nur von Schlangen mit schwererem Körperbau verwendet. Dabei wird<br />
die Haut auf der Unterseite durch starke Muskeln vor und zurückbewegt, und die breiten Bauchschilder<br />
greifen in den Untergrund und bewegen dadurch die Schlange vorwärts. Diese Fortbewegungs-<br />
138