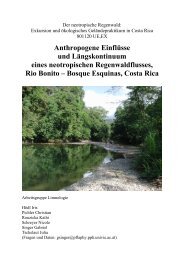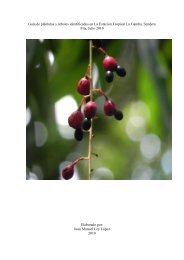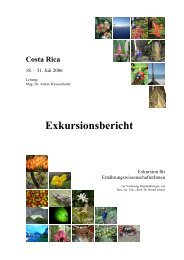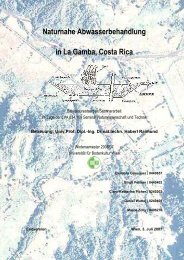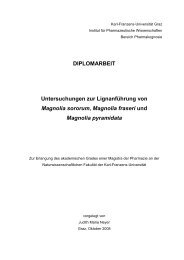Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Michaela Seiz, Birgit Wondratsch<br />
Interaktionen zwischen Pflanzen und Tieren<br />
eingraben, um Vorräte für schlechtere Zeiten zu schaffen. Sie legen viele Vorratslager mit wenigen<br />
Samen an, da diese nun auch für andere Tiere zur Beute werden, wie z.B. für Pecari-Schweine.<br />
Agutis verfügen zwar über ein hervorragendes Gedächtnis, aber dennoch vergessen sie einige der zahlreichen<br />
Verstecke und so können die Samen keimen.<br />
Somit sind Agutis der einzige natürliche Samenverbreiter des Paranussbaums. Leider gehört das Aguti<br />
selbst zu den gefährdeten Tierarten und ist ebenfalls auf der roten Liste der IUCN. Es ist begehrte<br />
Beute für Jaguare, Coyoten oder Ozelots; auch Menschen machen Jagd auf den Nager. Das zarte<br />
Fleisch gilt als Delikatesse, auch wenn die Jagd auf das Aguti inzwischen verboten ist.<br />
Das Überleben des Paranussbaums hängt übrigens nicht nur von diesem einen Mutualismus ab. Nicht<br />
nur die Samen können nur von einem einzigen Tier verbreitet werden, auch die Bestäubung ist nur von<br />
einem einzigen Insekt durchführbar: der großen weiblichen Orchideenbiene (Euglossa). Ihre Zunge<br />
ist lang genug, um in die großen Blüten zu gelangen, zudem legen sie große Distanzen zurück und<br />
erreichen so andere Paranussbäume, die oft in einiger Entfernung zueinander stehen. Die Bienen benötigen<br />
noch andere Nahrungsquellen, da die Paranuss nicht das ganze Jahr über blüht. Euglossa leben<br />
solitär und können nicht vergesellschaftet werden – ein Grund, warum man sie nicht auf Plantagen<br />
züchten und die Paranuss nicht kultiviert werden kann. Darüber hinaus benötigen die Männchen dieser<br />
Spezies Düfte einer bestimmten Orchideenart, um die Weibchen anzulocken – diese wären in einer<br />
künstlichen Paranussmonokultur natürlich nicht zu finden. Die Männchen benötigen die Orchideen,<br />
um Weibchen anzulocken, die Paranuss benötigt die Weibchen zu ihrer Bestäubung. Das komplizierte<br />
Zusammenspiel dieser vielen Organismen erschwert es der Paranuss, sich auszubreiten und ihren<br />
Fortbestand zu sichern.<br />
5.7.4 Beziehungen zwischen Ameisen und Pflanzen<br />
ENTDECKUNG, FUNKTION UND MECHANISMUS<br />
Zwischen tausenden Arten von Ameisen und Pflanzen gibt es Beziehungen, meist parasitischer Natur.<br />
Neben Parasitismus existieren auch Formen, in denen sich Pflanze und Ameise weder nutzen noch<br />
schaden und solche, in denen sie hoch entwickelte Symbiosen eingehen.<br />
Diese findet man bei den so genannten Myrmekophyten (Ameisenpflanzen), die den Ameisen nicht<br />
nur Nahrung, sondern auch Wohnraum bieten und im Gegenzug von diesen gegen Fressfeinde und<br />
sogar Konkurrenzpflanzen verteidigt werden.<br />
Schutz durch Ameisen ist weltweit verbreitet, aber nicht jede Beziehung zwischen Ameisen und<br />
Pflanzen gestattet die Bezeichnung „Ameisenpflanze“. Vielfach wohnen Ameisen in durch Fäulnis<br />
ausgehöhlten Bäumen, dies ist nicht mit Myrmecophytismus gleichzusetzen.<br />
Janzens (geb. 1939) Untersuchungen der Acacia ergaben eindeutige Hinweise auf eine Coevolution.<br />
Coevolution bedeutet, dass zwei Organismen sich in Abstimmung aufeinander entwickelt haben. Eine<br />
Gegentheorie besagt, dass die Anpassungen der Pflanze unabhängig von der Ameise entstanden sind<br />
und erst später von diesen genutzt wurden.<br />
Die aggressive Verteidigung der Pflanzen durch die Ameisen ist nach Barbara Bentley (1976) eine<br />
Anpassung des Verhaltens – auch Fleisch fressende Ameisen beschützen eine Pflanze, wenn Zuckerwasser<br />
auf ihr versprüht wurde. Die Ameisen nutzen die Pflanze darüber hinaus zur Anlockung anderer<br />
Insekten, um diese zu fressen.<br />
Die sich zersetzenden Ameisenleichen düngen die Pflanze; organischer Abfall, den die Ameisen anhäufen,<br />
enthält oft Stickstoff und Phosphor, welche ebenfalls als Dünger dienen.<br />
Als Bestäuber spielt die Ameise eine eher geringe Rolle – in den Blüten hinterlassen sie häufig Zerstörungen,<br />
weswegen die extrafloralen Nektarien unter anderem als Ablenkung entwickelt wurden. Auch<br />
dienen klebrige Zonen um die Blüte deren Schutz. Auf der glatten Körperoberfläche der Ameisen<br />
bleiben die Pollen kaum haften, die Ameise putzt sich häufig und scheidet antibakterielle Substanzen<br />
aus, die den Pollen schaden. Da die Ameise zu Fuß nur geringe Entfernungen zurücklegt, bleibt die<br />
genetisch günstige Fremdbestäubung oft aus.<br />
Die Ameisen tragen Samen in ihr Nest. Auf dem Weg gehen viele davon verloren, wodurch die Ameisen<br />
eine Rolle als Samenverbreiter spielen (Myrmekochorie). Da der Same der Ameise als Nahrung<br />
dient und dadurch viele der wertvollen Samen verloren gehen, hat die Pflanze Samenanhängsel entwickelt,<br />
die Elaiosomen (Ameisenbrot). Der Same selbst wird hier nicht mehr gefressen, sondern nur<br />
die ölreichen Anhängsel.<br />
170