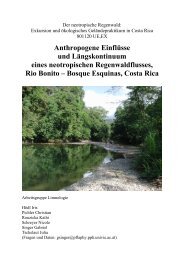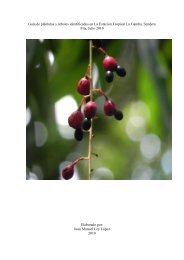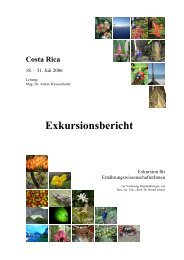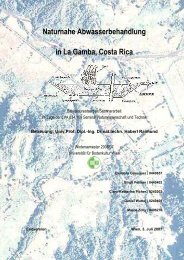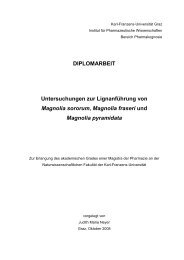Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Exkursionsbericht - Tropenstation | La Gamba
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Michaela Seiz, Birgit Wondratsch<br />
Interaktionen zwischen Pflanzen und Tieren<br />
In der Cecropia findet eine interessante Symbiose statt. Neben den Nektarien und den Futterkörpern<br />
bezieht die Ameise Energie aus einer weiteren Nahrungsquelle: Schildläuse, die sie im Inneren des<br />
Hohlstamms „halten“. Schildläuse besitzen die Fähigkeit, den stark zuckerhaltigen Assimilationssaft<br />
aus den Leitbahnen (Phloem) der Pflanze zu saugen. Sie verwerten die Aminosäuren und scheiden den<br />
Zuckersaft als Kot, den Honigtau, ab. Dieser dient vor allem der Ernährung der jungen Ameisen.<br />
5.7.5 Tarnung<br />
FUNKTION UND TARNUNGSARTEN<br />
Um sich vor Fressfeinden zu schützen oder auch um besser jagen zu können, bedienen sich Tiere einer<br />
meist visuellen Tarnung. Tiere bewerkstelligen dies auf unterschiedlichste Arten, welche sind:<br />
• Somatolyse: Darunter bezeichnet man die Anpassung an die Struktur und Färbung der Umgebung,<br />
sodass die Tiere quasi unsichtbar werden. Beispiele dafür wären der Tiger, das Zebra<br />
oder der Eisbär.<br />
• Mimese: Diese ist nicht scharf abzugrenzen von der Somatolyse. Tiere mit Tarnung, die in<br />
diese Gruppe fallen, ahmen meist unbelebte Gegenstände ihrer Umgebung nach, wie etwa<br />
Steine, Äste oder Blätter. Stabschrecken ähneln mit ihrem Körperbau einem Ast, während<br />
Gespenstschrecken an ein Blatt erinnern.<br />
• Mimikry: Manche Tierarten ahmen Tiere nach, die mit ihren Warnfarben Räubern ihre Ungenießbarkeit<br />
oder sogar Giftigkeit signalisieren, obwohl sie selbst nicht giftig sind. Einige<br />
Schlangenarten und Schmetterlingsraupen hoffen, so getarnt, von Fressfeinden verschont zu<br />
werden.<br />
• Gegenschattierung: Da Vögel und Fische in einem dreidimensionalen Habitat leben und<br />
somit von oben, als auch von unten angegriffen werden können, müssen sie sich ebenfalls<br />
tarnen. Die Unterseite ist hell gefärbt, da ja bekanntlich die Sonne von oben scheint; die Oberseite<br />
ist dunkel, wie der Untergrund.<br />
• Farbänderung: Unabhängig voneinander entwickelt besitzen manche Tierarten die Fähigkeit,<br />
ihre Farbe zu ändern, um sich an den wechselnden Untergrund anzupassen. Das bekannteste<br />
Beispiel wäre das Chamäleon, aber auch Rochen und andere Plattfische können ihre Farbe<br />
wechseln. Ebenfalls hierzu zählt der Schneehase, der sein Fell nach Jahresverlauf wechselt:<br />
sein Sommerfell ist grau-braun, im Winter ist es weiß.<br />
• Industriemelanismus: Da die einst helle Birkenrinde auf Grund der Luftverschmutzung der<br />
Industriebetriebe mit Ruß geschwärzt wurde, waren die hellen Birkenspanner (eine Schmetterlingsart)<br />
nicht mehr gut gegen den dunklen Untergrund getarnt und fielen Fressfeinden zum<br />
Opfer. Die ursprünglich seltenen dunklen Artgenossen hatten somit einen Überlebensvorteil<br />
und setzten sich genetisch durch.<br />
Einige Tierarten können sich jedoch nicht selbst tarnen, sondern brauchen „Gehilfen“ – ein Beispiel<br />
wäre das Faultier.<br />
FAULTIERE UND ALGEN<br />
Seit seiner Entdeckung im 16. Jahrhundert galt das Faultier als träge, hässlich und wertlos. Erst als<br />
Wissenschaftler in der Mitte des 20. Jahrhunderts das Tier näher erforschten, konnte seine <strong>La</strong>ngsamkeit<br />
endlich nicht nur mit einfacher Faulheit erklärt werden.<br />
Das Faultier der Unterordnung Folivora ist ein wahrer Energiesparer. Es lebt kopfüber hängend in<br />
Bäumen – damit das Regenwasser besser abfließen kann hat es seinen Scheitel am Bauch – und ernährt<br />
sich fast ausschließlich von Blättern, einer nährstoffarmen Kost. Um sich die mühsam erworbene<br />
Energie zu bewahren, bewegt es sich so wenig wie möglich. Anders als bei anderen Säugetieren, bei<br />
denen die Verdauung meist nur einige Stunden dauert, braucht die aufgenommene Nahrung beim<br />
Faultier oft mehr als eine Woche, um den Verdauungstrakt zu passieren, damit eine maximale Absorption<br />
gewährleistet werden kann. Auch muss das Faultier für eine optimale Verdauung seine normalerweise<br />
relativ niedrige Körpertemperatur anheben, was es durch Sonnenbaden bewerkstelligt. Durch<br />
sein dickes Fell kann es die so gewonnene Wärme eine Weile beibehalten. Etwa ein Mal pro Woche<br />
173