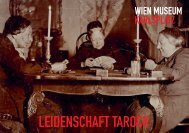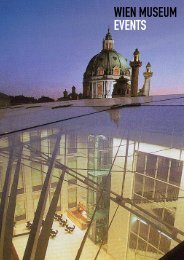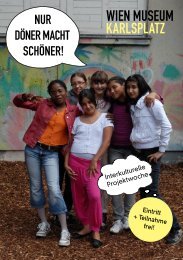Achter Bericht des amtsführenden Stadtrates für - Wien Museum
Achter Bericht des amtsführenden Stadtrates für - Wien Museum
Achter Bericht des amtsführenden Stadtrates für - Wien Museum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
vielleicht nie zustandegekommenen Verkauf eine nur <strong>für</strong> Guido Adler bestimmte, grobe<br />
Schätzung der Bilder vorgenommen hat.<br />
In seiner Vermögensanmeldung vom 13. Juli bzw. 16. August 1938 gab Guido Adler<br />
keine Kunstgegenstände an. Der Enkel hält es in seinem Dossier <strong>für</strong> möglich, dass<br />
Alfred Orel bei der Beschlagnahme der Bände „Denkmäler der Tonkunst in Österreich“<br />
in der Pogromnacht <strong>des</strong> 10. November 1938 noch andere Wertgegenstände aus dem<br />
Haus Guido Adlers entwendet hat. Quasi als Beweis führt der Enkel an, dass Guido<br />
Adler in seiner wenige Tage später erstellten Veränderungsanzeige an die VVSt. vom<br />
12. November 1938 keine Kunstgegenstände anführt. Zumin<strong>des</strong>t dieser Beweis vermag<br />
wenig zu überzeugen, denn Adler hatte bekanntlich schon vorher keine diesbezüglichen<br />
Angaben gemacht.<br />
Nach dem Tod Univ. Prof. Dr. Guido Adlers am 15. Februar 1941 setzten die<br />
Konkurrenzkämpfe der Behörden, Dienststellen und Institute ein, um sich die im<br />
Nachlass Adlers befindliche Bibliothek, die Manuskriptensammlung und die Sammlung<br />
von Originalbriefen entgegen der Absicht der Universalerbin Melanie Adler, diese<br />
Gegenstände zu verkaufen, anzueignen. Unmittelbar nach dem Tod Guido Adlers<br />
begann Univ. Prof. Dr. Erich Schenk, ein Schüler Adlers und seit 1940 Leiter <strong>des</strong><br />
Instituts <strong>für</strong> Musikwissenschaften, die Bibliothek und den wissenschaftlichen Nachlass<br />
durch eine eigenmächtige Sicherstellung <strong>für</strong> sich bzw. <strong>für</strong> das Institut zu beanspruchen.<br />
Als Schenk am 31. März 1941 das Reichsministerium <strong>für</strong> Wissenschaft, Erziehung und<br />
Volksbildung (REM) über sein Vorgehen informierte, opponierte der Generaldirektor der<br />
Nationalbibliothek, Paul Heigl, dagegen. Die Geheime Staatspolizei,<br />
Staatspolizeileitstelle <strong>Wien</strong>, informierte Heigl am 4. April 1941, „dass über Ersuchen <strong>des</strong><br />
Rektors Pg. Dr. Knoll und der Generaldirektion der Nationalbibliothek … bis zum<br />
Abschluss der Verkaufsverhandlungen die aus dem Nachlass <strong>des</strong> Verstorbenen<br />
stammende Bibliothek in der Villa, <strong>Wien</strong> 19., Lannerstraße 9, zur Gänze<br />
staatspolizeilich sichergestellt“ worden sei: „Die Bücherei habe ich dem<br />
gaurechtamtlichen Vertreter der Erbin … <strong>des</strong> Verlasses, Rechtsanwalt Dr. Richard<br />
Heiserer, <strong>Wien</strong> 1., Opernring 1., in Verwahrung gegeben.“ 83 Mit der Bestellung<br />
Heiserers verlor Melanie Adler das freie Verfügungsrecht, wie sie auch am 4. Mai 1941<br />
83 Zit. in: Murray G. Hall, Christina Köstner, … Allerlei <strong>für</strong> die Nationalbibliothek zu ergattern … Eine österreichische<br />
Institution in der NS-Zeit, <strong>Wien</strong> Köln Weimar 2006, S. 294.<br />
182