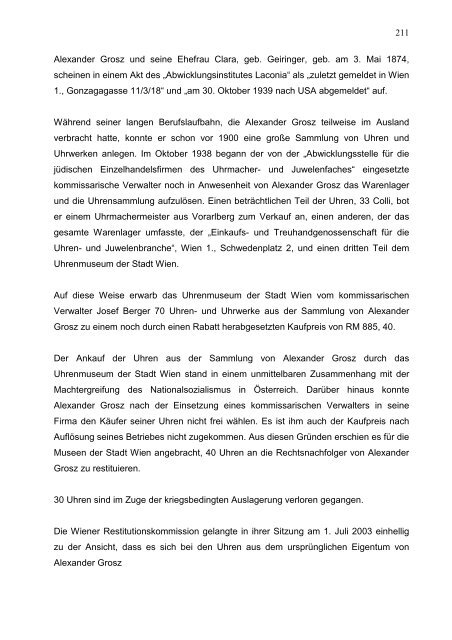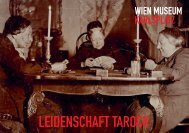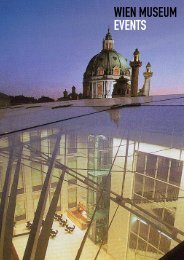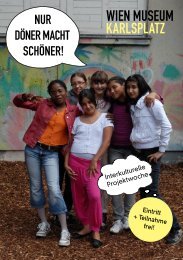Achter Bericht des amtsführenden Stadtrates für - Wien Museum
Achter Bericht des amtsführenden Stadtrates für - Wien Museum
Achter Bericht des amtsführenden Stadtrates für - Wien Museum
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Alexander Grosz und seine Ehefrau Clara, geb. Geiringer, geb. am 3. Mai 1874,<br />
scheinen in einem Akt <strong>des</strong> „Abwicklungsinstitutes Laconia“ als „zuletzt gemeldet in <strong>Wien</strong><br />
1., Gonzagagasse 11/3/18“ und „am 30. Oktober 1939 nach USA abgemeldet“ auf.<br />
Während seiner langen Berufslaufbahn, die Alexander Grosz teilweise im Ausland<br />
verbracht hatte, konnte er schon vor 1900 eine große Sammlung von Uhren und<br />
Uhrwerken anlegen. Im Oktober 1938 begann der von der „Abwicklungsstelle <strong>für</strong> die<br />
jüdischen Einzelhandelsfirmen <strong>des</strong> Uhrmacher- und Juwelenfaches“ eingesetzte<br />
kommissarische Verwalter noch in Anwesenheit von Alexander Grosz das Warenlager<br />
und die Uhrensammlung aufzulösen. Einen beträchtlichen Teil der Uhren, 33 Colli, bot<br />
er einem Uhrmachermeister aus Vorarlberg zum Verkauf an, einen anderen, der das<br />
gesamte Warenlager umfasste, der „Einkaufs- und Treuhandgenossenschaft <strong>für</strong> die<br />
Uhren- und Juwelenbranche“, <strong>Wien</strong> 1., Schwedenplatz 2, und einen dritten Teil dem<br />
Uhrenmuseum der Stadt <strong>Wien</strong>.<br />
Auf diese Weise erwarb das Uhrenmuseum der Stadt <strong>Wien</strong> vom kommissarischen<br />
Verwalter Josef Berger 70 Uhren- und Uhrwerke aus der Sammlung von Alexander<br />
Grosz zu einem noch durch einen Rabatt herabgesetzten Kaufpreis von RM 885, 40.<br />
Der Ankauf der Uhren aus der Sammlung von Alexander Grosz durch das<br />
Uhrenmuseum der Stadt <strong>Wien</strong> stand in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der<br />
Machtergreifung <strong>des</strong> Nationalsozialismus in Österreich. Darüber hinaus konnte<br />
Alexander Grosz nach der Einsetzung eines kommissarischen Verwalters in seine<br />
Firma den Käufer seiner Uhren nicht frei wählen. Es ist ihm auch der Kaufpreis nach<br />
Auflösung seines Betriebes nicht zugekommen. Aus diesen Gründen erschien es <strong>für</strong> die<br />
Museen der Stadt <strong>Wien</strong> angebracht, 40 Uhren an die Rechtsnachfolger von Alexander<br />
Grosz zu restituieren.<br />
30 Uhren sind im Zuge der kriegsbedingten Auslagerung verloren gegangen.<br />
Die <strong>Wien</strong>er Restitutionskommission gelangte in ihrer Sitzung am 1. Juli 2003 einhellig<br />
zu der Ansicht, dass es sich bei den Uhren aus dem ursprünglichen Eigentum von<br />
Alexander Grosz<br />
211