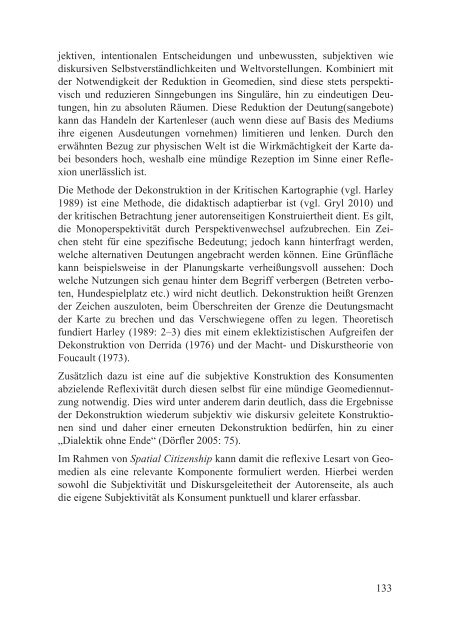Download (3152Kb) - Universität Oldenburg
Download (3152Kb) - Universität Oldenburg
Download (3152Kb) - Universität Oldenburg
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
jektiven, intentionalen Entscheidungen und unbewussten, subjektiven wie<br />
diskursiven Selbstverständlichkeiten und Weltvorstellungen. Kombiniert mit<br />
der Notwendigkeit der Reduktion in Geomedien, sind diese stets perspektivisch<br />
und reduzieren Sinngebungen ins Singuläre, hin zu eindeutigen Deutungen,<br />
hin zu absoluten Räumen. Diese Reduktion der Deutung(sangebote)<br />
kann das Handeln der Kartenleser (auch wenn diese auf Basis des Mediums<br />
ihre eigenen Ausdeutungen vornehmen) limitieren und lenken. Durch den<br />
erwähnten Bezug zur physischen Welt ist die Wirkmächtigkeit der Karte dabei<br />
besonders hoch, weshalb eine mündige Rezeption im Sinne einer Reflexion<br />
unerlässlich ist.<br />
Die Methode der Dekonstruktion in der Kritischen Kartographie (vgl. Harley<br />
1989) ist eine Methode, die didaktisch adaptierbar ist (vgl. Gryl 2010) und<br />
der kritischen Betrachtung jener autorenseitigen Konstruiertheit dient. Es gilt,<br />
die Monoperspektivität durch Perspektivenwechsel aufzubrechen. Ein Zeichen<br />
steht für eine spezifische Bedeutung; jedoch kann hinterfragt werden,<br />
welche alternativen Deutungen angebracht werden können. Eine Grünfläche<br />
kann beispielsweise in der Planungskarte verheißungsvoll aussehen: Doch<br />
welche Nutzungen sich genau hinter dem Begriff verbergen (Betreten verboten,<br />
Hundespielplatz etc.) wird nicht deutlich. Dekonstruktion heißt Grenzen<br />
der Zeichen auszuloten, beim Überschreiten der Grenze die Deutungsmacht<br />
der Karte zu brechen und das Verschwiegene offen zu legen. Theoretisch<br />
fundiert Harley (1989: 2–3) dies mit einem eklektizistischen Aufgreifen der<br />
Dekonstruktion von Derrida (1976) und der Macht- und Diskurstheorie von<br />
Foucault (1973).<br />
Zusätzlich dazu ist eine auf die subjektive Konstruktion des Konsumenten<br />
abzielende Reflexivität durch diesen selbst für eine mündige Geomediennutzung<br />
notwendig. Dies wird unter anderem darin deutlich, dass die Ergebnisse<br />
der Dekonstruktion wiederum subjektiv wie diskursiv geleitete Konstruktionen<br />
sind und daher einer erneuten Dekonstruktion bedürfen, hin zu einer<br />
„Dialektik ohne Ende“ (Dörfler 2005: 75).<br />
Im Rahmen von Spatial Citizenship kann damit die reflexive Lesart von Geomedien<br />
als eine relevante Komponente formuliert werden. Hierbei werden<br />
sowohl die Subjektivität und Diskursgeleitetheit der Autorenseite, als auch<br />
die eigene Subjektivität als Konsument punktuell und klarer erfassbar.<br />
133