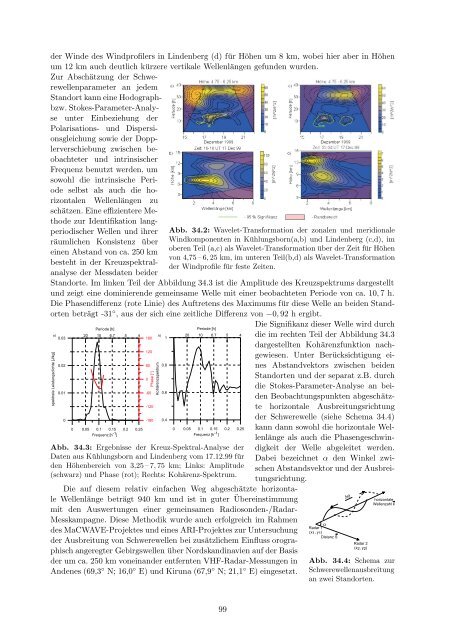Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
der Winde des Windprofilers in Lindenberg (d) <strong>für</strong> Höhen um 8 km, wobei hier aber in Höhen<br />
um 12 km auch deutlich kürzere vertikale Wellenlängen gefunden wurden.<br />
Zur Abschätzung der Schwerewellenparameter<br />
an jedem<br />
Standort kann eine Hodographbzw.Stokes-Parameter-Analyse<br />
unter Einbeziehung der<br />
Polarisations- und Dispersionsgleichung<br />
sowie der Dopplerverschiebung<br />
zwischen beobachteter<br />
und intrinsischer<br />
Frequenz benutzt werden, um<br />
sowohl die intrinsische Periode<br />
selbst als auch die horizontalen<br />
Wellenlängen zu<br />
schätzen. Eine effizientere Methode<br />
zur Identifikation langperiodischer<br />
Wellen und ihrer Abb. 34.2: Wavelet-Transformation der zonalen und meridionale<br />
räumlichen Konsistenz über<br />
einen Abstand von ca. 250 km<br />
besteht in der Kreuzspektralanalyse<br />
der Messdaten beider<br />
Windkomponenten in Kühlungsborn(a,b) und Lindenberg (c,d), im<br />
oberen Teil (a,c) als Wavelet-Transformation über der Zeit <strong>für</strong> Höhen<br />
von 4,75 – 6, 25 km, im unteren Teil(b,d) als Wavelet-Transformation<br />
der Windprofile <strong>für</strong> feste Zeiten.<br />
Standorte. Im linken Teil der Abbildung 34.3 ist die Amplitude des Kreuzspektrums dargestellt<br />
und zeigt eine dominierende gemeinsame Welle mit einer beobachteten Periode von ca. 10, 7 h.<br />
Die Phasendifferenz (rote Linie) des Auftretens des Maximums <strong>für</strong> diese Welle an beiden Standorten<br />
beträgt -31◦ , aus der sich eine zeitliche Differenz von −0, 92 h ergibt.<br />
0 0.05 0.1 0.15<br />
Frequenz [h<br />
0.2 0.25<br />
-1 0.03<br />
20<br />
Periode [h]<br />
10 6.7 5 4<br />
180<br />
120<br />
0.02<br />
60<br />
0<br />
0.01<br />
-60<br />
-120<br />
0<br />
]<br />
-180<br />
0 0.05 0.1 0.15<br />
Frequenz [h<br />
0.2 0.25<br />
-1 Die Signifikanz dieser Welle wird durch<br />
a) b)<br />
1<br />
20<br />
Periode [h]<br />
10 6.7 5 4 die im rechten Teil der Abbildung 34.3<br />
dargestellten Kohärenzfunktion nachgewiesen.<br />
Unter Berücksichtigung ei-<br />
0.8<br />
nes Abstandvektors zwischen beiden<br />
Standorten und der separat z.B. durch<br />
die Stokes-Parameter-Analyse an bei-<br />
0.6<br />
den Beobachtungspunkten abgeschätzte<br />
horizontale Ausbreitungsrichtung<br />
0.4<br />
]<br />
der Schwerewelle (siehe Schema 34.4)<br />
kann dann sowohl die horizontale Wellenlänge<br />
als auch die Phasengeschwin-<br />
Abb. 34.3: Ergebnisse der Kreuz-Spektral-Analyse der digkeit der Welle abgeleitet werden.<br />
Daten aus Kühlungsborn and Lindenberg vom 17.12.99 <strong>für</strong><br />
den Höhenbereich von 3,25 – 7, 75 km; Links: Amplitude<br />
(schwarz) und Phase (rot); Rechts: Kohärenz-Spektrum.<br />
Dabei bezeichnet α den Winkel zwischen<br />
Abstandsvektor und der Ausbreitungsrichtung.<br />
spektrale Leistungsdichte [J/kg]<br />
Phase [°]<br />
Kohärenzspektrum<br />
Die auf diesem relativ einfachen Weg abgeschätzte horizontale<br />
Wellenlänge beträgt 940 km und ist in guter Übereinstimmung<br />
mit den Auswertungen einer gemeinsamen Radiosonden-/Radar-<br />
Messkampagne. Diese Methodik wurde auch erfolgreich im Rahmen<br />
des MaCWAVE-Projektes und eines ARI-Projektes zur Untersuchung<br />
der Ausbreitung von Schwerewellen bei zusätzlichem Einfluss orographisch<br />
angeregter Gebirgswellen über Nordskandinavien auf der Basis<br />
der um ca. 250 km voneinander entfernten VHF-Radar-Messungen in<br />
Andenes (69,3 ◦ N; 16,0 ◦ E) und Kiruna (67,9 ◦ N; 21,1 ◦ E) eingesetzt.<br />
99<br />
�<br />
Radar 1<br />
(x1, y1)<br />
Distanz S<br />
��<br />
Radar 2<br />
(x2, y2)<br />
horizontale<br />
Wellenzahl k<br />
Abb. 34.4: Schema zur<br />
Schwerewellenausbreitung<br />
an zwei Standorten.