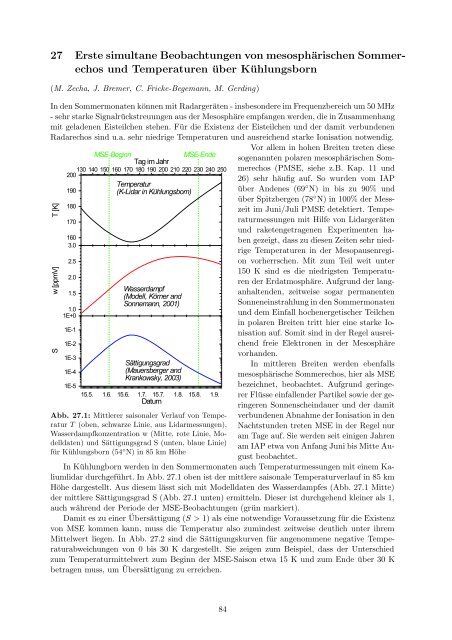Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
27 Erste simultane Beobachtungen von mesosphärischen Sommerechos<br />
und Temperaturen über Kühlungsborn<br />
(M. Zecha, J. Bremer, C. Fricke-Begemann, M. Gerding)<br />
In den Sommermonaten können mit Radargeräten - insbesondere im Frequenzbereich um 50 MHz<br />
- sehr starke Signalrückstreuungen aus der Mesosphäre empfangen werden, die in Zusammenhang<br />
mit geladenen Eisteilchen stehen. Für die Existenz der Eisteilchen und der damit verbundenen<br />
Radarechos sind u.a. sehr niedrige Temperaturen und ausreichend starke Ionisation notwendig.<br />
Abb. 27.1: Mittlerer saisonaler Verlauf von Temperatur<br />
T (oben, schwarze Linie, aus Lidarmessungen),<br />
Wasserdampfkonzentration w (Mitte, rote Linie, Modelldaten)<br />
und Sättigungsgrad S (unten, blaue Linie)<br />
<strong>für</strong> Kühlungsborn (54◦ Vor allem in hohen Breiten treten diese<br />
sogenannten polaren mesosphärischen Sommerechos<br />
(PMSE, siehe z.B. Kap. 11 und<br />
26) sehr häufig auf. So wurden vom IAP<br />
über Andenes (69<br />
N) in 85 km Höhe<br />
◦N) in bis zu 90% und<br />
über Spitzbergen (78◦N) in 100% der Messzeit<br />
im Juni/Juli PMSE detektiert. Temperaturmessungen<br />
mit Hilfe von Lidargeräten<br />
und raketengetragenen Experimenten haben<br />
gezeigt, dass zu diesen Zeiten sehr niedrige<br />
Temperaturen in der Mesopausenregion<br />
vorherrschen. Mit zum Teil weit unter<br />
150 K sind es die niedrigsten Temperaturen<br />
der Erdatmosphäre. Aufgrund der langanhaltenden,<br />
zeitweise sogar permanenten<br />
Sonneneinstrahlung in den Sommermonaten<br />
und dem Einfall hochenergetischer Teilchen<br />
in polaren Breiten tritt hier eine starke Ionisation<br />
auf. Somit sind in der Regel ausreichend<br />
freie Elektronen in der Mesosphäre<br />
vorhanden.<br />
In mittleren Breiten werden ebenfalls<br />
mesosphärische Sommerechos, hier als MSE<br />
bezeichnet, beobachtet. Aufgrund geringerer<br />
Flüsse einfallender Partikel sowie der geringeren<br />
Sonnenscheindauer und der damit<br />
verbundenen Abnahme der Ionisation in den<br />
Nachtstunden treten MSE in der Regel nur<br />
am Tage auf. Sie werden seit einigen Jahren<br />
am IAP etwa von Anfang Juni bis Mitte August<br />
beobachtet.<br />
In Kühlungborn werden in den Sommermonaten auch Temperaturmessungen mit einem Kaliumlidar<br />
durchgeführt. In Abb. 27.1 oben ist der mittlere saisonale Temperaturverlauf in 85 km<br />
Höhe dargestellt. Aus diesem lässt sich mit Modelldaten des Wasserdampfes (Abb. 27.1 Mitte)<br />
der mittlere Sättigungsgrad S (Abb. 27.1 unten) ermitteln. Dieser ist durchgehend kleiner als 1,<br />
auch während der Periode der MSE-Beobachtungen (grün markiert).<br />
Damit es zu einer Übersättigung (S > 1) als eine notwendige Voraussetzung <strong>für</strong> die Existenz<br />
von MSE kommen kann, muss die Temperatur also zumindest zeitweise deutlich unter ihrem<br />
Mittelwert liegen. In Abb. 27.2 sind die Sättigungskurven <strong>für</strong> angenommene negative Temperaturabweichungen<br />
von 0 bis 30 K dargestellt. Sie zeigen zum Beispiel, dass der Unterschied<br />
zum Temperaturmittelwert zum Beginn der MSE-Saison etwa 15 K und zum Ende über 30 K<br />
betragen muss, um Übersättigung zu erreichen.<br />
84