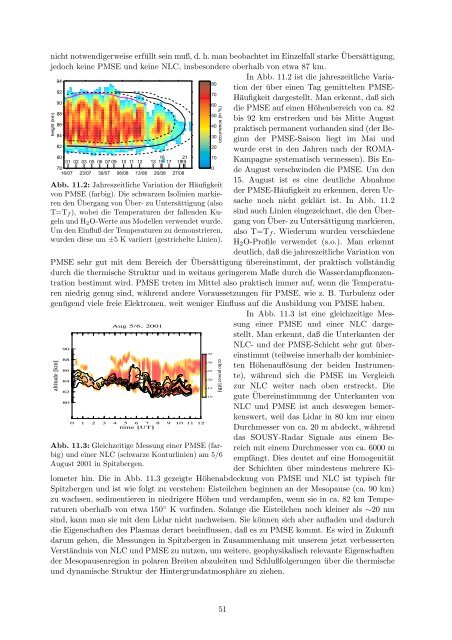Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
nicht notwendigerweise erfüllt sein muß, d. h. man beobachtet im Einzelfall starke Übersättigung,<br />
jedoch keine PMSE und keine NLC, insbesondere oberhalb von etwa 87 km.<br />
94<br />
92<br />
90<br />
88<br />
86<br />
84<br />
82<br />
80<br />
01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 15<br />
78<br />
16/07 23/07 30/07 06/08 13/08 20/08 27/08<br />
16 17 1819 21<br />
In Abb. 11.2 ist die jahreszeitliche Varia-<br />
80<br />
tion der über einen Tag gemittelten PMSE-<br />
70<br />
Häufigkeit dargestellt. Man erkennt, daß sich<br />
60<br />
die PMSE auf einen Höhenbereich von ca. 82<br />
50<br />
bis 92 km erstrecken und bis Mitte August<br />
40 praktisch permanent vorhanden sind (der Be-<br />
30 ginn der PMSE-Saison liegt im Mai und<br />
20 wurde erst in den Jahren nach der ROMA-<br />
10 Kampagne systematisch vermessen). Bis En-<br />
0 de August verschwinden die PMSE. Um den<br />
15. August ist es eine deutliche Abnahme<br />
Abb. 11.2: Jahreszeitliche Variation der Häufigkeit<br />
von PMSE (farbig). Die schwarzen Isolinien markie-<br />
der PMSE-Häufigkeit zu erkennen, deren Urren<br />
den Übergang von Über- zu Untersättigung (also sache noch nicht geklärt ist. In Abb. 11.2<br />
T=Tf), wobei die Temperaturen der fallenden Ku- sind auch Linien eingezeichnet, die den Übergeln<br />
und H2O-Werte aus Modellen verwendet wurde. gang von Über- zu Untersättigung markieren,<br />
Um den Einfluß der Temperaturen zu demonstrieren, also T=Tf. Wiederum wurden verschiedene<br />
wurden diese um ±5 K variiert (gestrichelte Linien). H2O-Profile verwendet (s.o.). Man erkennt<br />
deutlich, daß die jahreszeitliche Variation von<br />
PMSE sehr gut mit dem Bereich der Übersättigung übereinstimmt, der praktisch vollständig<br />
durch die thermische Struktur und in weitaus geringerem Maße durch die Wasserdampfkonzentration<br />
bestimmt wird. PMSE treten im Mittel also praktisch immer auf, wenn die Temperaturen<br />
niedrig genug sind, während andere Voraussetzungen <strong>für</strong> PMSE, wie z. B. Turbulenz oder<br />
genügend viele freie Elektronen, weit weniger Einfluss auf die Ausbildung von PMSE haben.<br />
In Abb. 11.3 ist eine gleichzeitige Messung<br />
einer PMSE und einer NLC dargestellt.<br />
Man erkennt, daß die Unterkanten der<br />
NLC- und der PMSE-Schicht sehr gut übereinstimmt<br />
(teilweise innerhalb der kombinierten<br />
Höhenauflösung der beiden Instrumente),<br />
während sich die PMSE im Vergleich<br />
zur NLC weiter nach oben erstreckt. Die<br />
gute Übereinstimmung der Unterkanten von<br />
NLC und PMSE ist auch deswegen bemerkenswert,<br />
weil das Lidar in 80 km nur einen<br />
Durchmesser von ca. 20 m abdeckt, während<br />
das SOUSY-Radar Signale aus einem Be-<br />
Abb. 11.3: Gleichzeitige Messung einer PMSE (farreich mit einem Durchmesser von ca. 6000 m<br />
big) und einer NLC (schwarze Konturlinien) am 5/6<br />
empfängt. Dies deutet auf eine Homogenität<br />
August 2001 in Spitzbergen.<br />
der Schichten über mindestens mehrere Kilometer<br />
hin. Die in Abb. 11.3 gezeigte Höhenabdeckung von PMSE und NLC ist typisch <strong>für</strong><br />
Spitzbergen und ist wie folgt zu verstehen: Eisteilchen beginnen an der Mesopause (ca. 90 km)<br />
zu wachsen, sedimentieren in niedrigere Höhen und verdampfen, wenn sie in ca. 82 km Temperaturen<br />
oberhalb von etwa 150◦ K vorfinden. Solange die Eisteilchen noch kleiner als ∼20 nm<br />
sind, kann man sie mit dem Lidar nicht nachweisen. Sie können sich aber aufladen und dadurch<br />
die Eigenschaften des Plasmas derart beeinflussen, daß es zu PMSE kommt. Es wird in Zukunft<br />
darum gehen, die Messungen in Spitzbergen in Zusammenhang mit unserem jetzt verbesserten<br />
Verständnis von NLC und PMSE zu nutzen, um weitere, geophysikalisch relevante Eigenschaften<br />
der Mesopausenregion in polaren Breiten abzuleiten und Schlußfolgerungen über die thermische<br />
und dynamische Struktur der Hintergrundatmosphäre zu ziehen.<br />
height (km)<br />
occurrence (in %)<br />
51