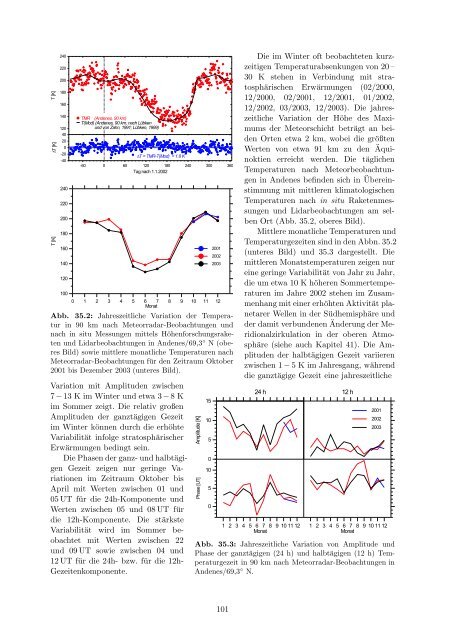Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abb. 35.2: Jahreszeitliche Variation der Temperatur<br />
in 90 km nach Meteorradar-Beobachtungen und<br />
nach in situ Messungen mittels Höhenforschungsraketen<br />
und Lidarbeobachtungen in Andenes/69,3 ◦ N (oberes<br />
Bild) sowie mittlere monatliche Temperaturen nach<br />
Meteorradar-Beobachtungen <strong>für</strong> den Zeitraum Oktober<br />
2001 bis Dezember <strong>2003</strong> (unteres Bild).<br />
Variation mit Amplituden zwischen<br />
7 − 13 K im Winter und etwa 3 − 8 K<br />
im Sommer zeigt. Die relativ großen<br />
Amplituden der ganztägigen Gezeit<br />
im Winter können durch die erhöhte<br />
Variabilität infolge stratosphärischer<br />
Erwärmungen bedingt sein.<br />
Die Phasen der ganz- und halbtägigen<br />
Gezeit zeigen nur geringe Variationen<br />
im Zeitraum Oktober bis<br />
April mit Werten zwischen 01 und<br />
05 UT <strong>für</strong> die 24h-Komponente und<br />
Werten zwischen 05 und 08 UT <strong>für</strong><br />
die 12h-Komponente. Die stärkste<br />
Variabilität wird im Sommer beobachtet<br />
mit Werten zwischen 22<br />
und 09 UT sowie zwischen 04 und<br />
12 UT <strong>für</strong> die 24h- bzw. <strong>für</strong> die 12h-<br />
Gezeitenkomponente.<br />
Die im Winter oft beobachteten kurzzeitigen<br />
Temperaturabsenkungen von 20 –<br />
30 K stehen in Verbindung mit stratosphärischen<br />
Erwärmungen (02/2000,<br />
12/2000, 02/2001, 12/2001, 01/<strong>2002</strong>,<br />
12/<strong>2002</strong>, 03/<strong>2003</strong>, 12/<strong>2003</strong>). Die jahreszeitliche<br />
Variation der Höhe des Maximums<br />
der Meteorschicht beträgt an beiden<br />
Orten etwa 2 km, wobei die größten<br />
Werten von etwa 91 km zu den Äquinoktien<br />
erreicht werden. Die täglichen<br />
Temperaturen nach Meteorbeobachtungen<br />
in Andenes befinden sich in Übereinstimmung<br />
mit mittleren klimatologischen<br />
Temperaturen nach in situ Raketenmessungen<br />
und Lidarbeobachtungen am selben<br />
Ort (Abb. 35.2, oberes Bild).<br />
Mittlere monatliche Temperaturen und<br />
Temperaturgezeiten sind in den Abbn. 35.2<br />
(unteres Bild) und 35.3 dargestellt. Die<br />
mittleren Monatstemperaturen zeigen nur<br />
eine geringe Variabilität von Jahr zu Jahr,<br />
die um etwa 10 K höheren Sommertemperaturen<br />
im Jahre <strong>2002</strong> stehen im Zusammenhang<br />
mit einer erhöhten Aktivität planetarer<br />
Wellen in der Südhemisphäre und<br />
der damit verbundenen Änderung der Meridionalzirkulation<br />
in der oberen Atmosphäre<br />
(siehe auch Kapitel 41). Die Amplituden<br />
der halbtägigen Gezeit variieren<br />
zwischen 1 − 5 K im Jahresgang, während<br />
die ganztägige Gezeit eine jahreszeitliche<br />
Abb. 35.3: Jahreszeitliche Variation von Amplitude und<br />
Phase der ganztägigen (24 h) und halbtägigen (12 h) Temperaturgezeit<br />
in 90 km nach Meteorradar-Beobachtungen in<br />
Andenes/69,3 ◦ N.<br />
101