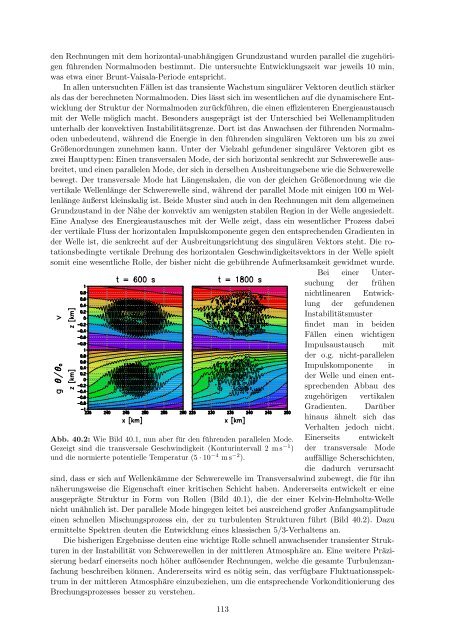Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
den Rechnungen mit dem horizontal-unabhängigen Grundzustand wurden parallel die zugehörigen<br />
führenden Normalmoden bestimmt. Die untersuchte Entwicklungszeit war jeweils 10 min,<br />
was etwa einer Brunt-Vaisala-Periode entspricht.<br />
In allen untersuchten Fällen ist das transiente Wachstum singulärer Vektoren deutlich stärker<br />
als das der berechneten Normalmoden. Dies lässt sich im wesentlichen auf die dynamischere Entwicklung<br />
der Struktur der Normalmoden zurückführen, die einen effizienteren Energieaustausch<br />
mit der Welle möglich macht. Besonders ausgeprägt ist der Unterschied bei Wellenamplituden<br />
unterhalb der konvektiven Instabilitätsgrenze. Dort ist das Anwachsen der führenden Normalmoden<br />
unbedeutend, während die Energie in den führenden singulären Vektoren um bis zu zwei<br />
Größenordnungen zunehmen kann. Unter der Vielzahl gefundener singulärer Vektoren gibt es<br />
zwei Haupttypen: Einen transversalen Mode, der sich horizontal senkrecht zur Schwerewelle ausbreitet,<br />
und einen parallelen Mode, der sich in derselben Ausbreitungsebene wie die Schwerewelle<br />
bewegt. Der transversale Mode hat Längenskalen, die von der gleichen Größenordnung wie die<br />
vertikale Wellenlänge der Schwerewelle sind, während der parallel Mode mit einigen 100 m Wellenlänge<br />
äußerst kleinskalig ist. Beide Muster sind auch in den Rechnungen mit dem allgemeinen<br />
Grundzustand in der Nähe der konvektiv am wenigsten stabilen Region in der Welle angesiedelt.<br />
Eine Analyse des Energieaustausches mit der Welle zeigt, dass ein wesentlicher Prozess dabei<br />
der vertikale Fluss der horizontalen Impulskomponente gegen den entsprechenden Gradienten in<br />
der Welle ist, die senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung des singulären Vektors steht. Die rotationsbedingte<br />
vertikale Drehung des horizontalen Geschwindigkeitsvektors in der Welle spielt<br />
somit eine wesentliche Rolle, der bisher nicht die gebührende Aufmerksamkeit gewidmet wurde.<br />
Abb. 40.2: Wie Bild 40.1, nun aber <strong>für</strong> den führenden parallelen Mode.<br />
Gezeigt sind die transversale Geschwindigkeit (Konturintervall 2 m s −1 )<br />
und die normierte potentielle Temperatur (5 · 10 −4 m s −2 ).<br />
Bei einer Untersuchung<br />
der frühen<br />
nichtlinearen Entwicklung<br />
der gefundenen<br />
Instabilitätsmuster<br />
findet man in beiden<br />
Fällen einen wichtigen<br />
Impulsaustausch mit<br />
der o.g. nicht-parallelen<br />
Impulskomponente in<br />
der Welle und einen entsprechenden<br />
Abbau des<br />
zugehörigen vertikalen<br />
Gradienten. Darüber<br />
hinaus ähnelt sich das<br />
Verhalten jedoch nicht.<br />
Einerseits entwickelt<br />
der transversale Mode<br />
auffällige Scherschichten,<br />
die dadurch verursacht<br />
sind, dass er sich auf Wellenkämme der Schwerewelle im Transversalwind zubewegt, die <strong>für</strong> ihn<br />
näherungsweise die Eigenschaft einer kritischen Schicht haben. Andererseits entwickelt er eine<br />
ausgeprägte Struktur in Form von Rollen (Bild 40.1), die der einer Kelvin-Helmholtz-Welle<br />
nicht unähnlich ist. Der parallele Mode hingegen leitet bei ausreichend großer Anfangsamplitude<br />
einen schnellen Mischungsprozess ein, der zu turbulenten Strukturen führt (Bild 40.2). Dazu<br />
ermittelte Spektren deuten die Entwicklung eines klassischen 5/3-Verhaltens an.<br />
Die bisherigen Ergebnisse deuten eine wichtige Rolle schnell anwachsender transienter Strukturen<br />
in der Instabilität von Schwerewellen in der mittleren Atmosphäre an. Eine weitere Präzisierung<br />
bedarf einerseits noch höher auflösender Rechnungen, welche die gesamte Turbulenzanfachung<br />
beschreiben können. Andererseits wird es nötig sein, das verfügbare Fluktuationsspektrum<br />
in der mittleren Atmosphäre einzubeziehen, um die entsprechende Vorkonditionierung des<br />
Brechungsprozesses besser zu verstehen.<br />
113