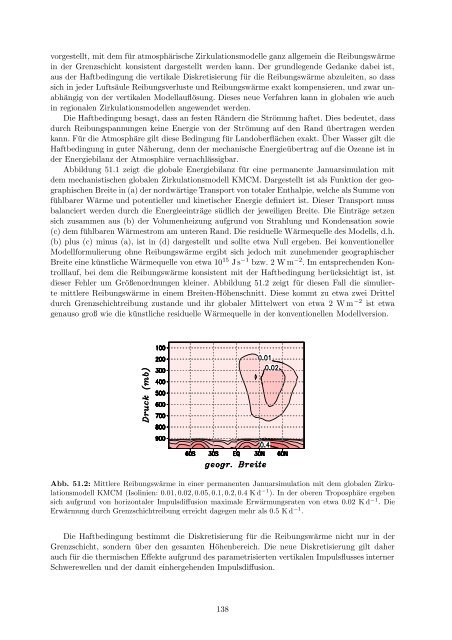Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
vorgestellt, mit dem <strong>für</strong> atmosphärische Zirkulationsmodelle ganz allgemein die Reibungswärme<br />
in der Grenzschicht konsistent dargestellt werden kann. Der grundlegende Gedanke dabei ist,<br />
aus der Haftbedingung die vertikale Diskretisierung <strong>für</strong> die Reibungswärme abzuleiten, so dass<br />
sich in jeder Luftsäule Reibungsverluste und Reibungswärme exakt kompensieren, und zwar unabhängig<br />
von der vertikalen Modellauflösung. Dieses neue Verfahren kann in globalen wie auch<br />
in regionalen Zirkulationsmodellen angewendet werden.<br />
Die Haftbedingung besagt, dass an festen Rändern die Strömung haftet. Dies bedeutet, dass<br />
durch Reibungspannungen keine Energie von der Strömung auf den Rand übertragen werden<br />
kann. Für die Atmosphäre gilt diese Bedingung <strong>für</strong> Landoberflächen exakt. Über Wasser gilt die<br />
Haftbedingung in guter Näherung, denn der mechanische Energieübertrag auf die Ozeane ist in<br />
der Energiebilanz der Atmosphäre vernachlässigbar.<br />
Abbildung 51.1 zeigt die globale Energiebilanz <strong>für</strong> eine permanente Januarsimulation mit<br />
dem mechanistischen globalen Zirkulationsmodell KMCM. Dargestellt ist als Funktion der geographischen<br />
Breite in (a) der nordwärtige Transport von totaler Enthalpie, welche als Summe von<br />
fühlbarer Wärme und potentieller und kinetischer Energie definiert ist. Dieser Transport muss<br />
balanciert werden durch die Energieeinträge südlich der jeweiligen Breite. Die Einträge setzen<br />
sich zusammen aus (b) der Volumenheizung aufgrund von Strahlung und Kondensation sowie<br />
(c) dem fühlbaren Wärmestrom am unteren Rand. Die residuelle Wärmequelle des Modells, d.h.<br />
(b) plus (c) minus (a), ist in (d) dargestellt und sollte etwa Null ergeben. Bei konventioneller<br />
Modellformulierung ohne Reibungswärme ergibt sich jedoch mit zunehmender geographischer<br />
Breite eine künstliche Wärmequelle von etwa 10 15 J s −1 bzw. 2 W m −2 . Im entsprechenden Kontrolllauf,<br />
bei dem die Reibungswärme konsistent mit der Haftbedingung berücksichtigt ist, ist<br />
dieser Fehler um Größenordnungen kleiner. Abbildung 51.2 zeigt <strong>für</strong> diesen Fall die simulierte<br />
mittlere Reibungswärme in einem Breiten-Höhenschnitt. Diese kommt zu etwa zwei Drittel<br />
durch Grenzschichtreibung zustande und ihr globaler Mittelwert von etwa 2 W m −2 ist etwa<br />
genauso groß wie die künstliche residuelle Wärmequelle in der konventionellen Modellversion.<br />
Abb. 51.2: Mittlere Reibungswärme in einer permanenten Januarsimulation mit dem globalen Zirkulationsmodell<br />
KMCM (Isolinien: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 K d −1 ). In der oberen Troposphäre ergeben<br />
sich aufgrund von horizontaler Impulsdiffusion maximale Erwärmungsraten von etwa 0.02 K d −1 . Die<br />
Erwärmung durch Grenzschichtreibung erreicht dagegen mehr als 0.5 K d −1 .<br />
Die Haftbedingung bestimmt die Diskretisierung <strong>für</strong> die Reibungswärme nicht nur in der<br />
Grenzschicht, sondern über den gesamten Höhenbereich. Die neue Diskretisierung gilt daher<br />
auch <strong>für</strong> die thermischen Effekte aufgrund des parametrisierten vertikalen Impulsflusses interner<br />
Schwerewellen und der damit einhergehenden Impulsdiffusion.<br />
138