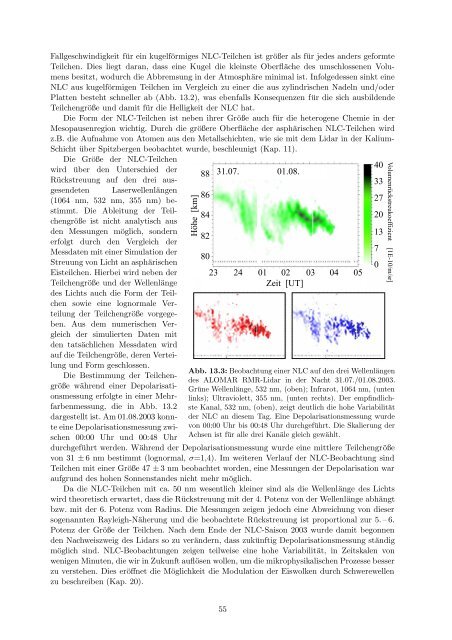Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fallgeschwindigkeit <strong>für</strong> ein kugelförmiges NLC-Teilchen ist größer als <strong>für</strong> jedes anders geformte<br />
Teilchen. Dies liegt daran, dass eine Kugel die kleinste Oberfläche des umschlossenen Volumens<br />
besitzt, wodurch die Abbremsung in der Atmosphäre minimal ist. Infolgedessen sinkt eine<br />
NLC aus kugelförmigen Teilchen im Vergleich zu einer die aus zylindrischen Nadeln und/oder<br />
Platten besteht schneller ab (Abb. 13.2), was ebenfalls Konsequenzen <strong>für</strong> die sich ausbildende<br />
Teilchengröße und damit <strong>für</strong> die Helligkeit der NLC hat.<br />
Die Form der NLC-Teilchen ist neben ihrer Größe auch <strong>für</strong> die heterogene Chemie in der<br />
Mesopausenregion wichtig. Durch die größere Oberfläche der asphärischen NLC-Teilchen wird<br />
z.B. die Aufnahme von Atomen aus den Metallschichten, wie sie mit dem Lidar in der Kalium-<br />
Schicht über Spitzbergen beobachtet wurde, beschleunigt (Kap. 11).<br />
Die Größe der NLC-Teilchen<br />
wird über den Unterschied der<br />
Rückstreuung auf den drei ausgesendeten<br />
Laserwellenlängen<br />
(1064 nm, 532 nm, 355 nm) bestimmt.<br />
Die Ableitung der Teilchengröße<br />
ist nicht analytisch aus<br />
den Messungen möglich, sondern<br />
erfolgt durch den Vergleich der<br />
Messdaten mit einer Simulation der<br />
Streuung von Licht an asphärischen<br />
Eisteilchen. Hierbei wird neben der<br />
Teilchengröße und der Wellenlänge<br />
des Lichts auch die Form der Teilchen<br />
sowie eine lognormale Verteilung<br />
der Teilchengröße vorgegeben.<br />
Aus dem numerischen Vergleich<br />
der simulierten Daten mit<br />
den tatsächlichen Messdaten wird<br />
auf die Teilchengröße, deren Verteilung<br />
und Form geschlossen.<br />
Die Bestimmung der Teilchengröße<br />
während einer Depolarisationsmessung<br />
erfolgte in einer Mehrfarbenmessung,<br />
die in Abb. 13.2<br />
dargestellt ist. Am 01.08.<strong>2003</strong> konnte<br />
eine Depolarisationsmessung zwischen<br />
00:00 Uhr und 00:48 Uhr<br />
Höhe [km]<br />
88<br />
86<br />
84<br />
82<br />
80<br />
31.07. 01.08.<br />
23 24 01 02 03 04 05<br />
Zeit [UT]<br />
Abb. 13.3: Beobachtung einer NLC auf den drei Wellenlängen<br />
des ALOMAR RMR-Lidar in der Nacht 31.07./01.08.<strong>2003</strong>.<br />
Grüne Wellenlänge, 532 nm, (oben); Infrarot, 1064 nm, (unten<br />
links); Ultraviolett, 355 nm, (unten rechts). Der empfindlichste<br />
Kanal, 532 nm, (oben), zeigt deutlich die hohe Variabilität<br />
der NLC an diesem Tag. Eine Depolarisationsmessung wurde<br />
von 00:00 Uhr bis 00:48 Uhr durchgeführt. Die Skalierung der<br />
Achsen ist <strong>für</strong> alle drei Kanäle gleich gewählt.<br />
durchgeführt werden. Während der Depolarisationsmessung wurde eine mittlere Teilchengröße<br />
von 31 ± 6 nm bestimmt (lognormal, σ=1,4). Im weiteren Verlauf der NLC-Beobachtung sind<br />
Teilchen mit einer Größe 47 ± 3 nm beobachtet worden, eine Messungen der Depolarisation war<br />
aufgrund des hohen Sonnenstandes nicht mehr möglich.<br />
Da die NLC-Teilchen mit ca. 50 nm wesentlich kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts<br />
wird theoretisch erwartet, dass die Rückstreuung mit der 4. Potenz von der Wellenlänge abhängt<br />
bzw. mit der 6. Potenz vom Radius. Die Messungen zeigen jedoch eine Abweichung von dieser<br />
sogenannten Rayleigh-Näherung und die beobachtete Rückstreuung ist proportional zur 5. – 6.<br />
Potenz der Größe der Teilchen. Nach dem Ende der NLC-Saison <strong>2003</strong> wurde damit begonnen<br />
den Nachweiszweig des Lidars so zu verändern, dass zukünftig Depolarisationsmessung ständig<br />
möglich sind. NLC-Beobachtungen zeigen teilweise eine hohe Variabilität, in Zeitskalen von<br />
wenigen Minuten, die wir in Zukunft auflösen wollen, um die mikrophysikalischen Prozesse besser<br />
zu verstehen. Dies eröffnet die Möglichkeit die Modulation der Eiswolken durch Schwerewellen<br />
zu beschreiben (Kap. 20).<br />
55<br />
40<br />
33<br />
27<br />
20<br />
13<br />
7<br />
0<br />
Volumenrückstreukoeffizient [1E-10/m/sr]