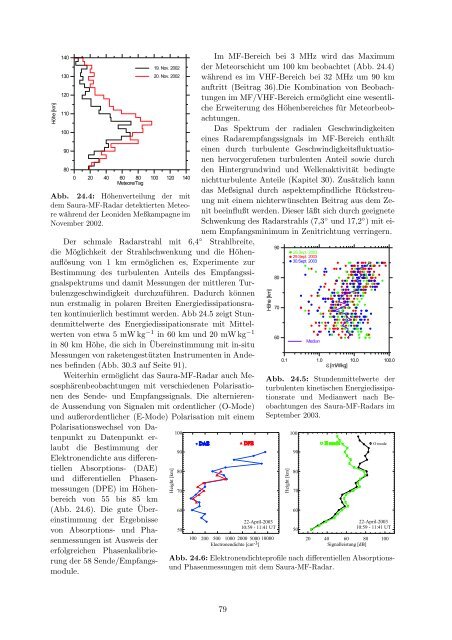Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb. 24.4: Höhenverteilung der mit<br />
dem Saura-MF-Radar detektierten Meteore<br />
während der Leoniden Meßkampagne im<br />
November <strong>2002</strong>.<br />
Der schmale Radarstrahl mit 6,4 ◦ Strahlbreite,<br />
die Möglichkeit der Strahlschwenkung und die Höhenauflösung<br />
von 1 km ermöglichen es, Experimente zur<br />
Bestimmung des turbulenten Anteils des Empfangssignalspektrums<br />
und damit Messungen der mittleren Turbulenzgeschwindigkeit<br />
durchzuführen. Dadurch können<br />
nun erstmalig in polaren Breiten Energiedissipationsraten<br />
kontinuierlich bestimmt werden. Abb 24.5 zeigt Stundenmittelwerte<br />
des Energiedissipationsrate mit Mittelwerten<br />
von etwa 5 mW kg −1 in 60 km und 20 mW kg −1<br />
in 80 km Höhe, die sich in Übereinstimmung mit in-situ<br />
Messungen von raketengestützten Instrumenten in Andenes<br />
befinden (Abb. 30.3 auf Seite 91).<br />
Weiterhin ermöglicht das Saura-MF-Radar auch Mesosphärenbeobachtungen<br />
mit verschiedenen Polarisationen<br />
des Sende- und Empfangssignals. Die alternierende<br />
Aussendung von Signalen mit ordentlicher (O-Mode)<br />
und außerordentlicher (E-Mode) Polarisation mit einem<br />
Polarisationswechsel von Datenpunkt<br />
zu Datenpunkt erlaubt<br />
die Bestimmung der<br />
Elektronendichte aus differentiellen<br />
Absorptions- (DAE)<br />
und differentiellen Phasenmessungen<br />
(DPE) im Höhenbereich<br />
von 55 bis 85 km<br />
(Abb. 24.6). Die gute Übereinstimmung<br />
der Ergebnisse<br />
von Absorptions- und Phasenmessungen<br />
ist Ausweis der<br />
erfolgreichen Phasenkalibrierung<br />
der 58 Sende/Empfangsmodule.<br />
Im MF-Bereich bei 3 MHz wird das Maximum<br />
der Meteorschicht um 100 km beobachtet (Abb. 24.4)<br />
während es im VHF-Bereich bei 32 MHz um 90 km<br />
auftritt (Beitrag 36).Die Kombination von Beobachtungen<br />
im MF/VHF-Bereich ermöglicht eine wesentliche<br />
Erweiterung des Höhenbereiches <strong>für</strong> Meteorbeobachtungen.<br />
Das Spektrum der radialen Geschwindigkeiten<br />
eines Radarempfangssignals im MF-Bereich enthält<br />
einen durch turbulente Geschwindigkeitsfluktuationen<br />
hervorgerufenen turbulenten Anteil sowie durch<br />
den Hintergrundwind und Wellenaktivität bedingte<br />
nichtturbulente Anteile (Kapitel 30). Zusätzlich kann<br />
das Meßsignal durch aspektempfindliche Rückstreuung<br />
mit einem nichterwünschten Beitrag aus dem Zenit<br />
beeinflußt werden. Dieser läßt sich durch geeignete<br />
Schwenkung des Radarstrahls (7,3 ◦ und 17,2 ◦ ) mit ei-<br />
nem Empfangsminimum in Zenitrichtung verringern.<br />
Abb. 24.5: Stundenmittelwerte der<br />
turbulenten kinetischen Energiedissipationsrate<br />
und Medianwert nach Beobachtungen<br />
des Saura-MF-Radars im<br />
September <strong>2003</strong>.<br />
Abb. 24.6: Elektronendichteprofile nach differentiellen Absorptionsund<br />
Phasenmessungen mit dem Saura-MF-Radar.<br />
79