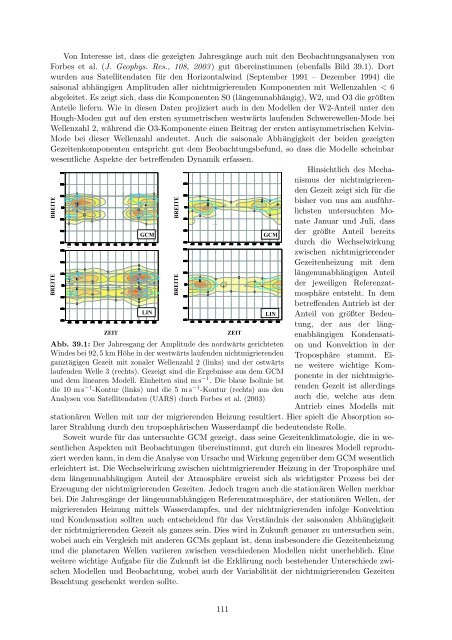Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Von Interesse ist, dass die gezeigten Jahresgänge auch mit den Beobachtungsanalysen von<br />
Forbes et al. (J. Geophys. Res., 108, <strong>2003</strong> ) gut übereinstimmen (ebenfalls Bild 39.1). Dort<br />
wurden aus Satellitendaten <strong>für</strong> den Horizontalwind (September 1991 – Dezember 1994) die<br />
saisonal abhängigen Amplituden aller nichtmigrierenden Komponenten mit Wellenzahlen < 6<br />
abgeleitet. Es zeigt sich, dass die Komponenten S0 (längenunabhängig), W2, und O3 die größten<br />
Anteile liefern. Wie in diesen Daten projiziert auch in den Modellen der W2-Anteil unter den<br />
Hough-Moden gut auf den ersten symmetrischen westwärts laufenden Schwerewellen-Mode bei<br />
Wellenzahl 2, während die O3-Komponente einen Beitrag der ersten antisymmetrischen Kelvin-<br />
Mode bei dieser Wellenzahl andeutet. Auch die saisonale Abhängigkeit der beiden gezeigten<br />
Gezeitenkomponenten entspricht gut dem Beobachtungsbefund, so dass die Modelle scheinbar<br />
wesentliche Aspekte der betreffenden Dynamik erfassen.<br />
Abb. 39.1: Der Jahresgang der Amplitude des nordwärts gerichteten<br />
Windes bei 92, 5 km Höhe in der westwärts laufenden nichtmigrierenden<br />
ganztägigen Gezeit mit zonaler Wellenzahl 2 (links) und der ostwärts<br />
laufenden Welle 3 (rechts). Gezeigt sind die Ergebnisse aus dem GCM<br />
und dem linearen Modell. Einheiten sind m s −1 . Die blaue Isolinie ist<br />
die 10 m s −1 -Kontur (links) und die 5 m s −1 -Kontur (rechts) aus den<br />
Analysen von Satellitendaten (UARS) durch Forbes et al. (<strong>2003</strong>)<br />
Hinsichtlich des Mechanismus<br />
der nichtmigrierenden<br />
Gezeit zeigt sich <strong>für</strong> die<br />
bisher von uns am ausführlichsten<br />
untersuchten Monate<br />
Januar und Juli, dass<br />
der größte Anteil bereits<br />
durch die Wechselwirkung<br />
zwischen nichtmigrierender<br />
Gezeitenheizung mit dem<br />
längenunabhängigen Anteil<br />
der jeweiligen Referenzatmosphäre<br />
entsteht. In dem<br />
betreffenden Antrieb ist der<br />
Anteil von größter Bedeutung,<br />
der aus der längenabhängigenKondensation<br />
und Konvektion in der<br />
Troposphäre stammt. Eine<br />
weitere wichtige Komponente<br />
in der nichtmigrierenden<br />
Gezeit ist allerdings<br />
auch die, welche aus dem<br />
Antrieb eines Modells mit<br />
stationären Wellen mit nur der migrierenden Heizung resultiert. Hier spielt die Absorption solarer<br />
Strahlung durch den troposphärischen Wasserdampf die bedeutendste Rolle.<br />
Soweit wurde <strong>für</strong> das untersuchte GCM gezeigt, dass seine Gezeitenklimatologie, die in wesentlichen<br />
Aspekten mit Beobachtungen übereinstimmt, gut durch ein lineares Modell reproduziert<br />
werden kann, in dem die Analyse von Ursache und Wirkung gegenüber dem GCM wesentlich<br />
erleichtert ist. Die Wechselwirkung zwischen nichtmigrierender Heizung in der Troposphäre und<br />
dem längenunabhängigen Anteil der Atmosphäre erweist sich als wichtigster Prozess bei der<br />
Erzeugung der nichtmigrierenden Gezeiten. Jedoch tragen auch die stationären Wellen merkbar<br />
bei. Die Jahresgänge der längenunabhängigen Referenzatmosphäre, der stationären Wellen, der<br />
migrierenden Heizung mittels Wasserdampfes, und der nichtmigrierenden infolge Konvektion<br />
und Kondensation sollten auch entscheidend <strong>für</strong> das Verständnis der saisonalen Abhängigkeit<br />
der nichtmigrierenden Gezeit als ganzes sein. Dies wird in Zukunft genauer zu untersuchen sein,<br />
wobei auch ein Vergleich mit anderen GCMs geplant ist, denn insbesondere die Gezeitenheizung<br />
und die planetaren Wellen variieren zwischen verschiedenen Modellen nicht unerheblich. Eine<br />
weitere wichtige Aufgabe <strong>für</strong> die Zukunft ist die Erklärung noch bestehender Unterschiede zwischen<br />
Modellen und Beobachtung, wobei auch der Variabilität der nichtmigrierenden Gezeiten<br />
Beachtung geschenkt werden sollte.<br />
111