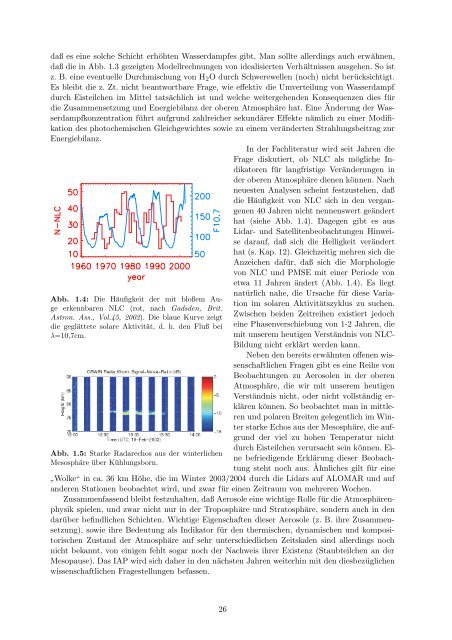Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
daß es eine solche Schicht erhöhten Wasserdampfes gibt. Man sollte allerdings auch erwähnen,<br />
daß die in Abb. 1.3 gezeigten Modellrechnungen von idealisierten Verhältnissen ausgehen. So ist<br />
z. B. eine eventuelle Durchmischung von H2O durch Schwerewellen (noch) nicht berücksichtigt.<br />
Es bleibt die z. Zt. nicht beantwortbare Frage, wie effektiv die Umverteilung von Wasserdampf<br />
durch Eisteilchen im Mittel tatsächlich ist und welche weitergehenden Konsequenzen dies <strong>für</strong><br />
die Zusammensetzung und Energiebilanz der oberen Atmosphäre hat. Eine Änderung der Wasserdampfkonzentration<br />
führt aufgrund zahlreicher sekundärer Effekte nämlich zu einer Modifikation<br />
des photochemischen Gleichgewichtes sowie zu einem veränderten Strahlungsbeitrag zur<br />
Energiebilanz.<br />
Abb. 1.4: Die Häufigkeit der mit bloßem Auge<br />
erkennbaren NLC (rot, nach Gadsden, Brit.<br />
Astron. Ass., Vol.45, <strong>2002</strong>). Die blaue Kurve zeigt<br />
die geglättete solare Aktivität, d. h. den Fluß bei<br />
λ=10,7cm.<br />
Abb. 1.5: Starke Radarechos aus der winterlichen<br />
Mesosphäre über Kühlungsborn.<br />
In der Fachliteratur wird seit Jahren die<br />
Frage diskutiert, ob NLC als mögliche Indikatoren<br />
<strong>für</strong> langfristige Veränderungen in<br />
der oberen Atmosphäre dienen können. Nach<br />
neuesten Analysen scheint festzustehen, daß<br />
die Häufigkeit von NLC sich in den vergangenen<br />
40 Jahren nicht nennenswert geändert<br />
hat (siehe Abb. 1.4). Dagegen gibt es aus<br />
Lidar- und Satellitenbeobachtungen Hinweise<br />
darauf, daß sich die Helligkeit verändert<br />
hat (s. Kap. 12). Gleichzeitig mehren sich die<br />
Anzeichen da<strong>für</strong>, daß sich die Morphologie<br />
von NLC und PMSE mit einer Periode von<br />
etwa 11 Jahren ändert (Abb. 1.4). Es liegt<br />
natürlich nahe, die Ursache <strong>für</strong> diese Variation<br />
im solaren Aktivitätszyklus zu suchen.<br />
Zwischen beiden Zeitreihen existiert jedoch<br />
eine Phasenverschiebung von 1-2 Jahren, die<br />
mit unserem heutigen Verständnis von NLC-<br />
Bildung nicht erklärt werden kann.<br />
Neben den bereits erwähnten offenen wissenschaftlichen<br />
Fragen gibt es eine Reihe von<br />
Beobachtungen zu Aerosolen in der oberen<br />
Atmosphäre, die wir mit unserem heutigen<br />
Verständnis nicht, oder nicht vollständig erklären<br />
können. So beobachtet man in mittleren<br />
und polaren Breiten gelegentlich im Winter<br />
starke Echos aus der Mesosphäre, die aufgrund<br />
der viel zu hohen Temperatur nicht<br />
durch Eisteilchen verursacht sein können. Eine<br />
befriedigende Erklärung dieser Beobachtung<br />
steht noch aus. Ähnliches gilt <strong>für</strong> eine<br />
” Wolke“ in ca. 36 km Höhe, die im Winter <strong>2003</strong>/2004 durch die Lidars auf ALOMAR und auf<br />
anderen Stationen beobachtet wird, und zwar <strong>für</strong> einen Zeitraum von mehreren Wochen.<br />
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daß Aerosole eine wichtige Rolle <strong>für</strong> die <strong>Atmosphärenphysik</strong><br />
spielen, und zwar nicht nur in der Troposphäre und Stratosphäre, sondern auch in den<br />
darüber befindlichen Schichten. Wichtige Eigenschaften dieser Aerosole (z. B. ihre Zusammensetzung),<br />
sowie ihre Bedeutung als Indikator <strong>für</strong> den thermischen, dynamischen und kompositorischen<br />
Zustand der Atmosphäre auf sehr unterschiedlichen Zeitskalen sind allerdings noch<br />
nicht bekannt, von einigen fehlt sogar noch der Nachweis ihrer Existenz (Staubteilchen an der<br />
Mesopause). Das IAP wird sich daher in den nächsten Jahren weiterhin mit den diesbezüglichen<br />
wissenschaftlichen Fragestellungen befassen.<br />
26