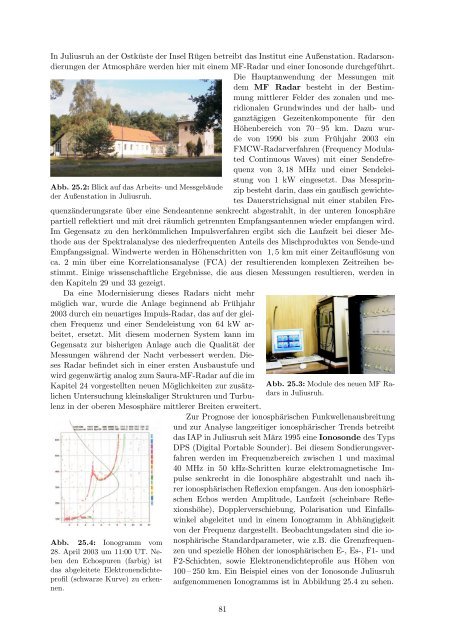Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
In Juliusruh an der Ostküste der Insel Rügen betreibt das <strong>Institut</strong> eine Außenstation. Radarsondierungen<br />
der Atmosphäre werden hier mit einem MF-Radar und einer Ionosonde durchgeführt.<br />
Die Hauptanwendung der Messungen mit<br />
dem MF Radar besteht in der Bestimmung<br />
mittlerer Felder des zonalen und meridionalen<br />
Grundwindes und der halb- und<br />
ganztägigen Gezeitenkomponente <strong>für</strong> den<br />
Höhenbereich von 70 – 95 km. Dazu wurde<br />
von 1990 bis zum Frühjahr <strong>2003</strong> ein<br />
FMCW-Radarverfahren (Frequency Modulated<br />
Continuous Waves) mit einer Sendefrequenz<br />
von 3, 18 MHz und einer Sendeleistung<br />
von 1 kW eingesetzt. Das Messprin-<br />
Abb. 25.2: Blick auf das Arbeits- und Messgebäude<br />
der Außenstation in Juliusruh.<br />
zip besteht darin, dass ein gaußisch gewichtetes<br />
Dauerstrichsignal mit einer stabilen Frequenzänderungsrate<br />
über eine Sendeantenne senkrecht abgestrahlt, in der unteren Ionosphäre<br />
partiell reflektiert und mit drei räumlich getrennten Empfangsantennen wieder empfangen wird.<br />
Im Gegensatz zu den herkömmlichen Impulsverfahren ergibt sich die Laufzeit bei dieser Methode<br />
aus der Spektralanalyse des niederfrequenten Anteils des Mischproduktes von Sende-und<br />
Empfangssignal. Windwerte werden in Höhenschritten von 1, 5 km mit einer Zeitauflösung von<br />
ca. 2 min über eine Korrelationsanalyse (FCA) der resultierenden komplexen Zeitreihen bestimmt.<br />
Einige wissenschaftliche Ergebnisse, die aus diesen Messungen resultieren, werden in<br />
den Kapiteln 29 und 33 gezeigt.<br />
Da eine Modernisierung dieses Radars nicht mehr<br />
möglich war, wurde die Anlage beginnend ab Frühjahr<br />
<strong>2003</strong> durch ein neuartiges Impuls-Radar, das auf der gleichen<br />
Frequenz und einer Sendeleistung von 64 kW arbeitet,<br />
ersetzt. Mit diesem modernen System kann im<br />
Gegensatz zur bisherigen Anlage auch die Qualität der<br />
Messungen während der Nacht verbessert werden. Dieses<br />
Radar befindet sich in einer ersten Ausbaustufe und<br />
wird gegenwärtig analog zum Saura-MF-Radar auf die im<br />
Kapitel 24 vorgestellten neuen Möglichkeiten zur zusätzlichen<br />
Untersuchung kleinskaliger Strukturen und Turbulenz<br />
in der oberen Mesosphäre mittlerer Breiten erweitert.<br />
Abb. 25.3: Module des neuen MF Radars<br />
in Juliusruh.<br />
Abb. 25.4: Ionogramm vom<br />
28. April <strong>2003</strong> um 11:00 UT. Ne-<br />
Zur Prognose der ionosphärischen Funkwellenausbreitung<br />
und zur Analyse langzeitiger ionosphärischer Trends betreibt<br />
das IAP in Juliusruh seit März 1995 eine Ionosonde des Typs<br />
DPS (Digital Portable Sounder). Bei diesem Sondierungsverfahren<br />
werden im Frequenzbereich zwischen 1 und maximal<br />
40 MHz in 50 kHz-Schritten kurze elektromagnetische Impulse<br />
senkrecht in die Ionosphäre abgestrahlt und nach ihrer<br />
ionosphärischen Reflexion empfangen. Aus den ionosphärischen<br />
Echos werden Amplitude, Laufzeit (scheinbare Reflexionshöhe),<br />
Dopplerverschiebung, Polarisation und Einfallswinkel<br />
abgeleitet und in einem Ionogramm in Abhängigkeit<br />
von der Frequenz dargestellt. Beobachtungsdaten sind die ionosphärische<br />
Standardparameter, wie z.B. die Grenzfrequenzen<br />
und spezielle Höhen der ionosphärischen E-, Es-, F1- und<br />
ben den Echospuren (farbig) ist F2-Schichten, sowie Elektronendichteprofile aus Höhen von<br />
das abgeleitete Elektronendichteprofil<br />
(schwarze Kurve) zu erkennen.<br />
100 – 250 km. Ein Beispiel eines von der Ionosonde Juliusruh<br />
aufgenommenen Ionogramms ist in Abbildung 25.4 zu sehen.<br />
81