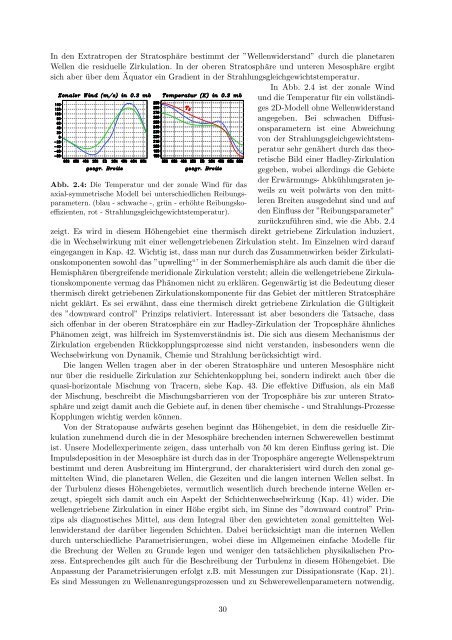Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In den Extratropen der Stratosphäre bestimmt der ”Wellenwiderstand” durch die planetaren<br />
Wellen die residuelle Zirkulation. In der oberen Stratosphäre und unteren Mesosphäre ergibt<br />
sich aber über dem Äquator ein Gradient in der Strahlungsgleichgewichtstemperatur.<br />
Abb. 2.4: Die Temperatur und der zonale Wind <strong>für</strong> das<br />
axial-symmetrische Modell bei unterschiedlichen Reibungsparametern.<br />
(blau - schwache -, grün - erhöhte Reibungskoeffizienten,<br />
rot - Strahlungsgleichgewichtstemperatur).<br />
In Abb. 2.4 ist der zonale Wind<br />
und die Temperatur <strong>für</strong> ein vollständiges<br />
2D-Modell ohne Wellenwiderstand<br />
angegeben. Bei schwachen Diffusionsparametern<br />
ist eine Abweichung<br />
von der Strahlungsgleichgewichtstemperatur<br />
sehr genähert durch das theoretische<br />
Bild einer Hadley-Zirkulation<br />
gegeben, wobei allerdings die Gebiete<br />
der Erwärmungs- Abkühlungsraten jeweils<br />
zu weit polwärts von den mittleren<br />
Breiten ausgedehnt sind und auf<br />
den Einfluss der ”Reibungsparameter”<br />
zurückzuführen sind, wie die Abb. 2.4<br />
zeigt. Es wird in diesem Höhengebiet eine thermisch direkt getriebene Zirkulation induziert,<br />
die in Wechselwirkung mit einer wellengetriebenen Zirkulation steht. Im Einzelnen wird darauf<br />
eingegangen in Kap. 42. Wichtig ist, dass man nur durch das Zusammenwirken beider Zirkulationskomponenten<br />
sowohl das ”upwelling“’ in der Sommerhemisphäre als auch damit die über die<br />
Hemisphären übergreifende meridionale Zirkulation versteht; allein die wellengetriebene Zirkulationskomponente<br />
vermag das Phänomen nicht zu erklären. Gegenwärtig ist die Bedeutung dieser<br />
thermisch direkt getriebenen Zirkulationskomponente <strong>für</strong> das Gebiet der mittleren Stratosphäre<br />
nicht geklärt. Es sei erwähnt, dass eine thermisch direkt getriebene Zirkulation die Gültigkeit<br />
des ”downward control” Prinzips relativiert. Interessant ist aber besonders die Tatsache, dass<br />
sich offenbar in der oberen Stratosphäre ein zur Hadley-Zirkulation der Troposphäre ähnliches<br />
Phänomen zeigt, was hilfreich im Systemverständnis ist. Die sich aus diesem Mechanismus der<br />
Zirkulation ergebenden Rückkopplungsprozesse sind nicht verstanden, insbesonders wenn die<br />
Wechselwirkung von Dynamik, Chemie und Strahlung berücksichtigt wird.<br />
Die langen Wellen tragen aber in der oberen Stratosphäre und unteren Mesosphäre nicht<br />
nur über die residuelle Zirkulation zur Schichtenkopplung bei, sondern indirekt auch über die<br />
quasi-horizontale Mischung von Tracern, siehe Kap. 43. Die effektive Diffusion, als ein Maß<br />
der Mischung, beschreibt die Mischungsbarrieren von der Troposphäre bis zur unteren Stratosphäre<br />
und zeigt damit auch die Gebiete auf, in denen über chemische - und Strahlungs-Prozesse<br />
Kopplungen wichtig werden können.<br />
Von der Stratopause aufwärts gesehen beginnt das Höhengebiet, in dem die residuelle Zirkulation<br />
zunehmend durch die in der Mesosphäre brechenden internen Schwerewellen bestimmt<br />
ist. Unsere Modellexperimente zeigen, dass unterhalb von 50 km deren Einfluss gering ist. Die<br />
Impulsdeposition in der Mesosphäre ist durch das in der Troposphäre angeregte Wellenspektrum<br />
bestimmt und deren Ausbreitung im Hintergrund, der charakterisiert wird durch den zonal gemittelten<br />
Wind, die planetaren Wellen, die Gezeiten und die langen internen Wellen selbst. In<br />
der Turbulenz dieses Höhengebietes, vermutlich wesentlich durch brechende interne Wellen erzeugt,<br />
spiegelt sich damit auch ein Aspekt der Schichtenwechselwirkung (Kap. 41) wider. Die<br />
wellengetriebene Zirkulation in einer Höhe ergibt sich, im Sinne des ”downward control” Prinzips<br />
als diagnostisches Mittel, aus dem Integral über den gewichteten zonal gemittelten Wellenwiderstand<br />
der darüber liegenden Schichten. Dabei berücksichtigt man die internen Wellen<br />
durch unterschiedliche Parametrisierungen, wobei diese im Allgemeinen einfache Modelle <strong>für</strong><br />
die Brechung der Wellen zu Grunde legen und weniger den tatsächlichen physikalischen Prozess.<br />
Entsprechendes gilt auch <strong>für</strong> die Beschreibung der Turbulenz in diesem Höhengebiet. Die<br />
Anpassung der Parametrisierungen erfolgt z.B. mit Messungen zur Dissipationsrate (Kap. 21).<br />
Es sind Messungen zu Wellenanregungsprozessen und zu Schwerewellenparametern notwendig,<br />
30