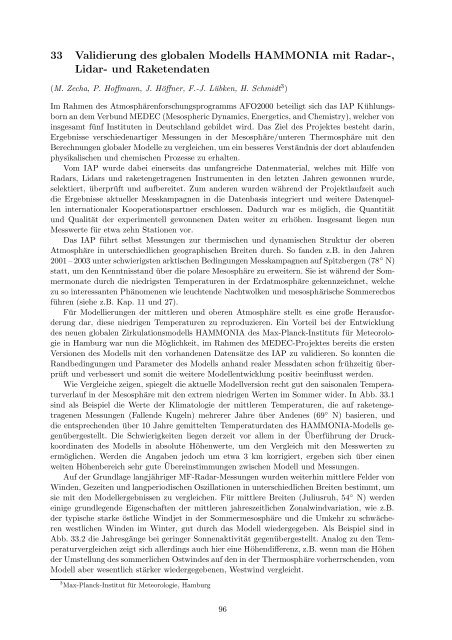Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
33 Validierung des globalen Modells HAMMONIA mit Radar-,<br />
Lidar- und Raketendaten<br />
(M. Zecha, P. Hoffmann, J. Höffner, F.-J. Lübken, H. Schmidt 3 )<br />
Im Rahmen des Atmosphärenforschungsprogramms AFO2000 beteiligt sich das IAP Kühlungsborn<br />
an dem Verbund MEDEC (Mesospheric Dynamics, Energetics, and Chemistry), welcher von<br />
insgesamt fünf <strong>Institut</strong>en in Deutschland gebildet wird. Das Ziel des Projektes besteht darin,<br />
Ergebnisse verschiedenartiger Messungen in der Mesosphäre/unteren Thermosphäre mit den<br />
Berechnungen globaler Modelle zu vergleichen, um ein besseres Verständnis der dort ablaufenden<br />
physikalischen und chemischen Prozesse zu erhalten.<br />
Vom IAP wurde dabei einerseits das umfangreiche Datenmaterial, welches mit Hilfe von<br />
Radars, Lidars und raketengetragenen Instrumenten in den letzten Jahren gewonnen wurde,<br />
selektiert, überprüft und aufbereitet. Zum anderen wurden während der Projektlaufzeit auch<br />
die Ergebnisse aktueller Messkampagnen in die Datenbasis integriert und weitere Datenquellen<br />
internationaler Kooperationspartner erschlossen. Dadurch war es möglich, die Quantität<br />
und Qualität der experimentell gewonnenen Daten weiter zu erhöhen. Insgesamt liegen nun<br />
Messwerte <strong>für</strong> etwa zehn Stationen vor.<br />
Das IAP führt selbst Messungen zur thermischen und dynamischen Struktur der oberen<br />
Atmosphäre in unterschiedlichen geographischen Breiten durch. So fanden z.B. in den Jahren<br />
2001 – <strong>2003</strong> unter schwierigsten arktischen Bedingungen Messkampagnen auf Spitzbergen (78 ◦ N)<br />
statt, um den Kenntnisstand über die polare Mesosphäre zu erweitern. Sie ist während der Sommermonate<br />
durch die niedrigsten Temperaturen in der Erdatmosphäre gekennzeichnet, welche<br />
zu so interessanten Phänomenen wie leuchtende Nachtwolken und mesosphärische Sommerechos<br />
führen (siehe z.B. Kap. 11 und 27).<br />
Für Modellierungen der mittleren und oberen Atmosphäre stellt es eine große Herausforderung<br />
dar, diese niedrigen Temperaturen zu reproduzieren. Ein Vorteil bei der Entwicklung<br />
des neuen globalen Zirkulationsmodells HAMMONIA des Max-Planck-<strong>Institut</strong>s <strong>für</strong> Meteorologie<br />
in Hamburg war nun die Möglichkeit, im Rahmen des MEDEC-Projektes bereits die ersten<br />
Versionen des Modells mit den vorhandenen Datensätze des IAP zu validieren. So konnten die<br />
Randbedingungen und Parameter des Modells anhand realer Messdaten schon frühzeitig überprüft<br />
und verbessert und somit die weitere Modellentwicklung positiv beeinflusst werden.<br />
Wie Vergleiche zeigen, spiegelt die aktuelle Modellversion recht gut den saisonalen Temperaturverlauf<br />
in der Mesosphäre mit den extrem niedrigen Werten im Sommer wider. In Abb. 33.1<br />
sind als Beispiel die Werte der Klimatologie der mittleren Temperaturen, die auf raketengetragenen<br />
Messungen (Fallende Kugeln) mehrerer Jahre über Andenes (69 ◦ N) basieren, und<br />
die entsprechenden über 10 Jahre gemittelten Temperaturdaten des HAMMONIA-Modells gegenübergestellt.<br />
Die Schwierigkeiten liegen derzeit vor allem in der Überführung der Druckkoordinaten<br />
des Modells in absolute Höhenwerte, um den Vergleich mit den Messwerten zu<br />
ermöglichen. Werden die Angaben jedoch um etwa 3 km korrigiert, ergeben sich über einen<br />
weiten Höhenbereich sehr gute Übereinstimmungen zwischen Modell und Messungen.<br />
Auf der Grundlage langjähriger MF-Radar-Messungen wurden weiterhin mittlere Felder von<br />
Winden, Gezeiten und langperiodischen Oszillationen in unterschiedlichen Breiten bestimmt, um<br />
sie mit den Modellergebnissen zu vergleichen. Für mittlere Breiten (Juliusruh, 54 ◦ N) werden<br />
einige grundlegende Eigenschaften der mittleren jahreszeitlichen Zonalwindvariation, wie z.B.<br />
der typische starke östliche Windjet in der Sommermesosphäre und die Umkehr zu schwächeren<br />
westlichen Winden im Winter, gut durch das Modell wiedergegeben. Als Beispiel sind in<br />
Abb. 33.2 die Jahresgänge bei geringer Sonnenaktivität gegenübergestellt. Analog zu den Temperaturvergleichen<br />
zeigt sich allerdings auch hier eine Höhendifferenz, z.B. wenn man die Höhen<br />
der Umstellung des sommerlichen Ostwindes auf den in der Thermosphäre vorherrschenden, vom<br />
Modell aber wesentlich stärker wiedergegebenen, Westwind vergleicht.<br />
3 Max-Planck-<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Meteorologie, Hamburg<br />
96