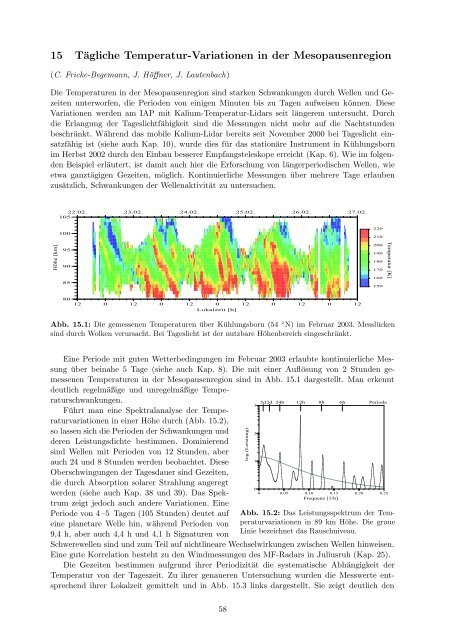Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
15 Tägliche Temperatur-Variationen in der Mesopausenregion<br />
(C. Fricke-Begemann, J. Höffner, J. Lautenbach)<br />
Die Temperaturen in der Mesopausenregion sind starken Schwankungen durch Wellen und Gezeiten<br />
unterworfen, die Perioden von einigen Minuten bis zu Tagen aufweisen können. Diese<br />
Variationen werden am IAP mit Kalium-Temperatur-Lidars seit längerem untersucht. Durch<br />
die Erlangung der Tageslichtfähigkeit sind die Messungen nicht mehr auf die Nachtstunden<br />
beschränkt. Während das mobile Kalium-Lidar bereits seit November 2000 bei Tageslicht einsatzfähig<br />
ist (siehe auch Kap. 10), wurde dies <strong>für</strong> das stationäre Instrument in Kühlungsborn<br />
im Herbst <strong>2002</strong> durch den Einbau besserer Empfangsteleskope erreicht (Kap. 6). Wie im folgenden<br />
Beispiel erläutert, ist damit auch hier die Erforschung von längerperiodischen Wellen, wie<br />
etwa ganztägigen Gezeiten, möglich. Kontinuierliche Messungen über mehrere Tage erlauben<br />
zusätzlich, Schwankungen der Wellenaktivität zu untersuchen.<br />
Höhe [km]<br />
22.02.<br />
105<br />
23.02. 24.02. 25.02. 26.02. 27.02.<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
12 0 12 0 12 0<br />
Lokalzeit [h]<br />
12 0 12 0 12<br />
Abb. 15.1: Die gemessenen Temperaturen über Kühlungsborn (54 ◦ N) im Februar <strong>2003</strong>. Messlücken<br />
sind durch Wolken verursacht. Bei Tageslicht ist der nutzbare Höhenbereich eingeschränkt.<br />
Eine Periode mit guten Wetterbedingungen im Februar <strong>2003</strong> erlaubte kontinuierliche Messung<br />
über beinahe 5 Tage (siehe auch Kap. 8). Die mit einer Auflösung von 2 Stunden ge-<br />
messenen Temperaturen in der Mesopausenregion sind in Abb. 15.1 dargestellt. Man erkennt<br />
deutlich regelmäßige und unregelmäßige Temperaturschwankungen.<br />
Führt man eine Spektralanalyse der Temperaturvariationen<br />
in einer Höhe durch (Abb. 15.2),<br />
so lassen sich die Perioden der Schwankungen und<br />
deren Leistungsdichte bestimmen. Dominierend<br />
sind Wellen mit Perioden von 12 Stunden, aber<br />
auch 24 und 8 Stunden werden beobachtet. Diese<br />
Oberschwingungen der Tagesdauer sind Gezeiten,<br />
die durch Absorption solarer Strahlung angeregt<br />
werden (siehe auch Kap. 38 und 39). Das Spektrum<br />
zeigt jedoch auch andere Variationen. Eine<br />
Periode von 4 –5 Tagen (105 Stunden) deutet auf<br />
eine planetare Welle hin, während Perioden von<br />
9,4 h, aber auch 4,4 h und 4,1 h Signaturen von<br />
log (Leistung)<br />
3<br />
2<br />
1<br />
5d2d 24h 12h 8h 6h<br />
220<br />
210<br />
200<br />
190<br />
180<br />
170<br />
160<br />
150<br />
Periode<br />
0<br />
0 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25<br />
Frequenz [1/h]<br />
Abb. 15.2: Das Leistungsspektrum der Temperaturvariationen<br />
in 89 km Höhe. Die graue<br />
Linie bezeichnet das Rauschniveau.<br />
Schwerewellen sind und zum Teil auf nichtlineare Wechselwirkungen zwischen Wellen hinweisen.<br />
Eine gute Korrelation besteht zu den Windmessungen des MF-Radars in Juliusruh (Kap. 25).<br />
Die Gezeiten bestimmen aufgrund ihrer Periodizität die systematische Abhängigkeit der<br />
Temperatur von der Tageszeit. Zu ihrer genaueren Untersuchung wurden die Messwerte entsprechend<br />
ihrer Lokalzeit gemittelt und in Abb. 15.3 links dargestellt. Sie zeigt deutlich den<br />
58<br />
Temperatur [K]