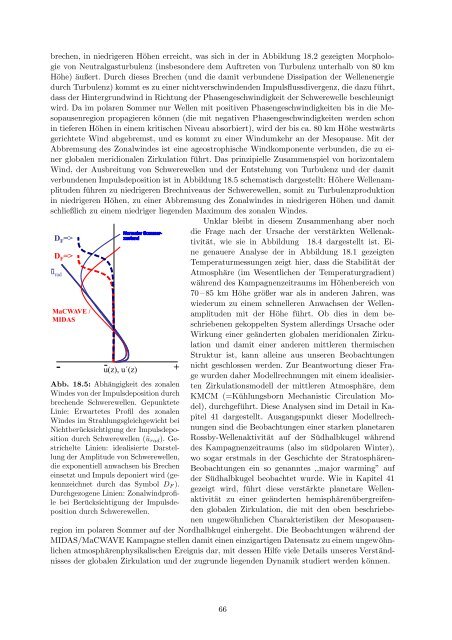Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
echen, in niedrigeren Höhen erreicht, was sich in der in Abbildung 18.2 gezeigten Morphologie<br />
von Neutralgasturbulenz (insbesondere dem Auftreten von Turbulenz unterhalb von 80 km<br />
Höhe) äußert. Durch dieses Brechen (und die damit verbundene Dissipation der Wellenenergie<br />
durch Turbulenz) kommt es zu einer nichtverschwindenden Impulsflussdivergenz, die dazu führt,<br />
dass der Hintergrundwind in Richtung der Phasengeschwindigkeit der Schwerewelle beschleunigt<br />
wird. Da im polaren Sommer nur Wellen mit positiven Phasengeschwindigkeiten bis in die Mesopausenregion<br />
propagieren können (die mit negativen Phasengeschwindigkeiten werden schon<br />
in tieferen Höhen in einem kritischen Niveau absorbiert), wird der bis ca. 80 km Höhe westwärts<br />
gerichtete Wind abgebremst, und es kommt zu einer Windumkehr an der Mesopause. Mit der<br />
Abbremsung des Zonalwindes ist eine ageostrophische Windkomponente verbunden, die zu einer<br />
globalen meridionalen Zirkulation führt. Das prinzipielle Zusammenspiel von horizontalem<br />
Wind, der Ausbreitung von Schwerewellen und der Entstehung von Turbulenz und der damit<br />
verbundenen Impulsdeposition ist in Abbildung 18.5 schematisch dargestellt: Höhere Wellenamplituden<br />
führen zu niedrigeren Brechniveaus der Schwerewellen, somit zu Turbulenzproduktion<br />
in niedrigeren Höhen, zu einer Abbremsung des Zonalwindes in niedrigeren Höhen und damit<br />
schließlich zu einem niedriger liegenden Maximum des zonalen Windes.<br />
Abb. 18.5: Abhängigkeit des zonalen<br />
Windes von der Impulsdeposition durch<br />
brechende Schwerewellen. Gepunktete<br />
Linie: Erwartetes Profil des zonalen<br />
Windes im Strahlungsgleichgewicht bei<br />
Nichtberücksichtigung der Impulsdeposition<br />
durch Schwerewellen (ūrad). Gestrichelte<br />
Linien: idealisierte Darstellung<br />
der Amplitude von Schwerewellen,<br />
die exponentiell anwachsen bis Brechen<br />
einsetzt und Impuls deponiert wird (gekennzeichnet<br />
durch das Symbol DF ).<br />
Durchgezogene Linien: Zonalwindprofile<br />
bei Berücksichtigung der Impulsdeposition<br />
durch Schwerewellen.<br />
Unklar bleibt in diesem Zusammenhang aber noch<br />
die Frage nach der Ursache der verstärkten Wellenaktivität,<br />
wie sie in Abbildung 18.4 dargestellt ist. Eine<br />
genauere Analyse der in Abbildung 18.1 gezeigten<br />
Temperaturmessungen zeigt hier, dass die Stabilität der<br />
Atmosphäre (im Wesentlichen der Temperaturgradient)<br />
während des Kampagnenzeitraums im Höhenbereich von<br />
70 – 85 km Höhe größer war als in anderen Jahren, was<br />
wiederum zu einem schnelleren Anwachsen der Wellenamplituden<br />
mit der Höhe führt. Ob dies in dem beschriebenen<br />
gekoppelten System allerdings Ursache oder<br />
Wirkung einer geänderten globalen meridionalen Zirkulation<br />
und damit einer anderen mittleren thermischen<br />
Struktur ist, kann alleine aus unseren Beobachtungen<br />
nicht geschlossen werden. Zur Beantwortung dieser Frage<br />
wurden daher Modellrechnungen mit einem idealisierten<br />
Zirkulationsmodell der mittleren Atmosphäre, dem<br />
KMCM (=Kühlungsborn Mechanistic Circulation Model),<br />
durchgeführt. Diese Analysen sind im Detail in Kapitel<br />
41 dargestellt. Ausgangspunkt dieser Modellrechnungen<br />
sind die Beobachtungen einer starken planetaren<br />
Rossby-Wellenaktivität auf der Südhalbkugel während<br />
des Kampagnenzeitraums (also im südpolaren Winter),<br />
wo sogar erstmals in der Geschichte der Stratosphären-<br />
Beobachtungen ein so genanntes ,,major warming” auf<br />
der Südhalbkugel beobachtet wurde. Wie in Kapitel 41<br />
gezeigt wird, führt diese verstärkte planetare Wellenaktivität<br />
zu einer geänderten hemisphärenübergreifenden<br />
globalen Zirkulation, die mit den oben beschriebenen<br />
ungewöhnlichen Charakteristiken der Mesopausen-<br />
region im polaren Sommer auf der Nordhalbkugel einhergeht. Die Beobachtungen während der<br />
MIDAS/MaCWAVE Kampagne stellen damit einen einzigartigen Datensatz zu einem ungewöhnlichen<br />
atmosphärenphysikalischen Ereignis dar, mit dessen Hilfe viele Details unseres Verständnisses<br />
der globalen Zirkulation und der zugrunde liegenden Dynamik studiert werden können.<br />
66