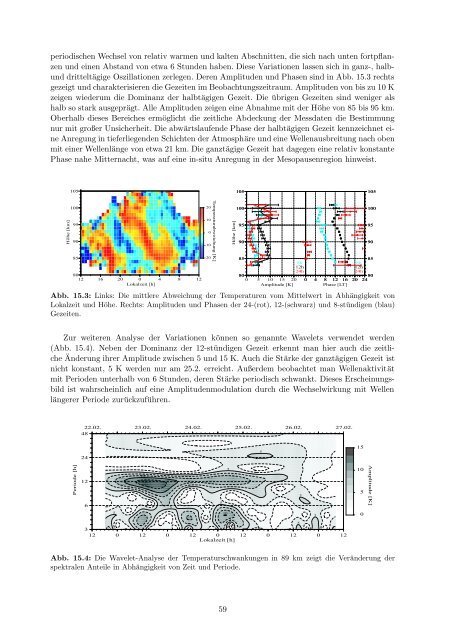Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
periodischen Wechsel von relativ warmen und kalten Abschnitten, die sich nach unten fortpflanzen<br />
und einen Abstand von etwa 6 Stunden haben. Diese Variationen lassen sich in ganz-, halbund<br />
dritteltägige Oszillationen zerlegen. Deren Amplituden und Phasen sind in Abb. 15.3 rechts<br />
gezeigt und charakterisieren die Gezeiten im Beobachtungszeitraum. Amplituden von bis zu 10 K<br />
zeigen wiederum die Dominanz der halbtägigen Gezeit. Die übrigen Gezeiten sind weniger als<br />
halb so stark ausgeprägt. Alle Amplituden zeigen eine Abnahme mit der Höhe von 85 bis 95 km.<br />
Oberhalb dieses Bereiches ermöglicht die zeitliche Abdeckung der Messdaten die Bestimmung<br />
nur mit großer Unsicherheit. Die abwärtslaufende Phase der halbtägigen Gezeit kennzeichnet eine<br />
Anregung in tieferliegenden Schichten der Atmosphäre und eine Wellenausbreitung nach oben<br />
mit einer Wellenlänge von etwa 21 km. Die ganztägige Gezeit hat dagegen eine relativ konstante<br />
Phase nahe Mitternacht, was auf eine in-situ Anregung in der Mesopausenregion hinweist.<br />
Höhe [km]<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
12 16 20 0<br />
Lokalzeit [h]<br />
4 8 12<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
Temperaturabweichung [K]<br />
Höhe [km]<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
85<br />
8h<br />
8h<br />
12h<br />
12h<br />
24h<br />
24h<br />
80<br />
80<br />
0 5 10 15 20 0 4 8 12 16 20 24<br />
Amplitude [K] Phase [LT]<br />
Abb. 15.3: Links: Die mittlere Abweichung der Temperaturen vom Mittelwert in Abhängigkeit von<br />
Lokalzeit und Höhe. Rechts: Amplituden und Phasen der 24-(rot), 12-(schwarz) und 8-stündigen (blau)<br />
Gezeiten.<br />
Zur weiteren Analyse der Variationen können so genannte Wavelets verwendet werden<br />
(Abb. 15.4). Neben der Dominanz der 12-stündigen Gezeit erkennt man hier auch die zeitliche<br />
Änderung ihrer Amplitude zwischen 5 und 15 K. Auch die Stärke der ganztägigen Gezeit ist<br />
nicht konstant, 5 K werden nur am 25.2. erreicht. Außerdem beobachtet man Wellenaktivität<br />
mit Perioden unterhalb von 6 Stunden, deren Stärke periodisch schwankt. Dieses Erscheinungsbild<br />
ist wahrscheinlich auf eine Amplitudenmodulation durch die Wechselwirkung mit Wellen<br />
längerer Periode zurückzuführen.<br />
Periode [h]<br />
22.02.<br />
48<br />
23.02. 24.02. 25.02. 26.02. 27.02.<br />
24<br />
12<br />
6<br />
5<br />
5<br />
10<br />
5<br />
5<br />
3<br />
12 0 12 0 12 0<br />
Lokalzeit [h]<br />
12 0 12 0 12<br />
5<br />
Abb. 15.4: Die Wavelet-Analyse der Temperaturschwankungen in 89 km zeigt die Veränderung der<br />
spektralen Anteile in Abhängigkeit von Zeit und Periode.<br />
10<br />
5<br />
59<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
5<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Amplitude [K]