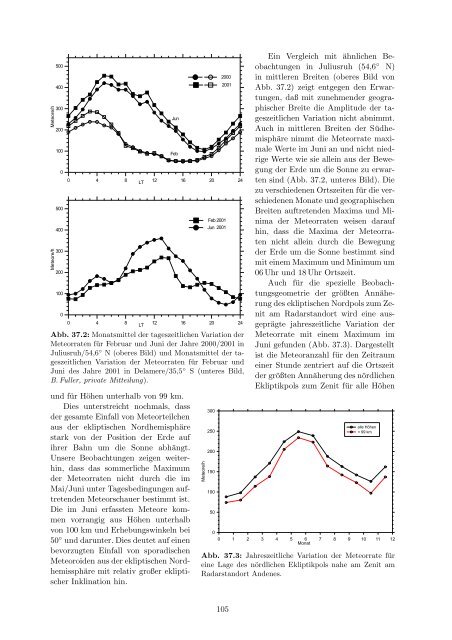Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb. 37.2: Monatsmittel der tageszeitlichen Variation der<br />
Meteorraten <strong>für</strong> Februar und Juni der Jahre 2000/2001 in<br />
Juliusruh/54,6 ◦ N (oberes Bild) und Monatsmittel der tageszeitlichen<br />
Variation der Meteorraten <strong>für</strong> Februar und<br />
Juni des Jahre 2001 in Delamere/35,5 ◦ S (unteres Bild,<br />
B. Fuller, private Mitteilung).<br />
und <strong>für</strong> Höhen unterhalb von 99 km.<br />
Dies unterstreicht nochmals, dass<br />
der gesamte Einfall von Meteorteilchen<br />
aus der ekliptischen Nordhemisphäre<br />
stark von der Position der Erde auf<br />
ihrer Bahn um die Sonne abhängt.<br />
Unsere Beobachtungen zeigen weiterhin,<br />
dass das sommerliche Maximum<br />
der Meteorraten nicht durch die im<br />
Mai/Juni unter Tagesbedingungen auftretenden<br />
Meteorschauer bestimmt ist.<br />
Die im Juni erfassten Meteore kommen<br />
vorrangig aus Höhen unterhalb<br />
von 100 km und Erhebungswinkeln bei<br />
50◦ und darunter. Dies deutet auf einen<br />
bevorzugten Einfall von sporadischen<br />
Meteoroiden aus der ekliptischen Nordhemissphäre<br />
mit relativ großer ekliptischer<br />
Inklination hin.<br />
Ein Vergleich mit ähnlichen Beobachtungen<br />
in Juliusruh (54,6 ◦ N)<br />
in mittleren Breiten (oberes Bild von<br />
Abb. 37.2) zeigt entgegen den Erwartungen,<br />
daß mit zunehmender geographischer<br />
Breite die Amplitude der tageszeitlichen<br />
Variation nicht abnimmt.<br />
Auch in mittleren Breiten der Südhemisphäre<br />
nimmt die Meteorrate maximale<br />
Werte im Juni an und nicht niedrige<br />
Werte wie sie allein aus der Bewegung<br />
der Erde um die Sonne zu erwarten<br />
sind (Abb. 37.2, unteres Bild). Die<br />
zu verschiedenen Ortszeiten <strong>für</strong> die verschiedenen<br />
Monate und geographischen<br />
Breiten auftretenden Maxima und Minima<br />
der Meteorraten weisen darauf<br />
hin, dass die Maxima der Meteorraten<br />
nicht allein durch die Bewegung<br />
der Erde um die Sonne bestimmt sind<br />
mit einem Maximum und Minimum um<br />
06 Uhr und 18 Uhr Ortszeit.<br />
Auch <strong>für</strong> die spezielle Beobachtungsgeometrie<br />
der größten Annäherung<br />
des ekliptischen Nordpols zum Zenit<br />
am Radarstandort wird eine ausgeprägte<br />
jahreszeitliche Variation der<br />
Meteorrate mit einem Maximum im<br />
Juni gefunden (Abb. 37.3). Dargestellt<br />
ist die Meteoranzahl <strong>für</strong> den Zeitraum<br />
einer Stunde zentriert auf die Ortszeit<br />
der größten Annäherung des nördlichen<br />
Ekliptikpols zum Zenit <strong>für</strong> alle Höhen<br />
Abb. 37.3: Jahreszeitliche Variation der Meteorrate <strong>für</strong><br />
eine Lage des nördlichen Ekliptikpols nahe am Zenit am<br />
Radarstandort Andenes.<br />
105