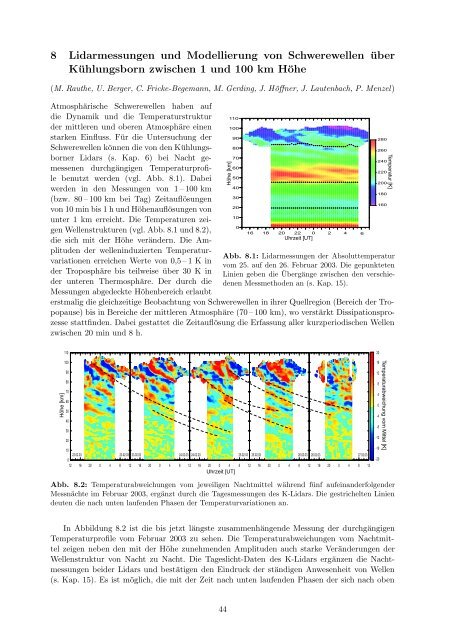Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
8 Lidarmessungen und Modellierung von Schwerewellen über<br />
Kühlungsborn zwischen 1 und 100 km Höhe<br />
(M. Rauthe, U. Berger, C. Fricke-Begemann, M. Gerding, J. Höffner, J. Lautenbach, P. Menzel)<br />
Atmosphärische Schwerewellen haben auf<br />
die Dynamik und die Temperaturstruktur<br />
der mittleren und oberen Atmosphäre einen<br />
starken Einfluss. Für die Untersuchung der<br />
Schwerewellen können die von den Kühlungsborner<br />
Lidars (s. Kap. 6) bei Nacht gemessenen<br />
durchgängigen Temperaturprofile<br />
benutzt werden (vgl. Abb. 8.1). Dabei<br />
werden in den Messungen von 1 – 100 km<br />
(bzw. 80 – 100 km bei Tag) Zeitauflösungen<br />
von 10 min bis 1 h und Höhenauflösungen von<br />
unter 1 km erreicht. Die Temperaturen zeigen<br />
Wellenstrukturen (vgl. Abb. 8.1 und 8.2),<br />
die sich mit der Höhe verändern. Die Amplituden<br />
der welleninduzierten Temperaturvariationen<br />
erreichen Werte von 0,5 – 1 K in<br />
der Troposphäre bis teilweise über 30 K in<br />
der unteren Thermosphäre. Der durch die<br />
Messungen abgedeckte Höhenbereich erlaubt<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
16 18 20 22 0 2 4 6<br />
Uhrzeit [UT]<br />
]<br />
erstmalig die gleichzeitige Beobachtung von Schwerewellen in ihrer Quellregion (Bereich der Tropopause)<br />
bis in Bereiche der mittleren Atmosphäre (70 – 100 km), wo verstärkt Dissipationsprozesse<br />
stattfinden. Dabei gestattet die Zeitauflösung die Erfassung aller kurzperiodischen Wellen<br />
zwischen 20 min und 8 h.<br />
Höhe [km]<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
Höhe [km]<br />
280<br />
260<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
Abb. 8.1: Lidarmessungen der Absoluttemperatur<br />
vom 25. auf den 26. Februar <strong>2003</strong>. Die gepunkteten<br />
Linien geben die Übergänge zwischen den verschiedenen<br />
Messmethoden an (s. Kap. 15).<br />
10<br />
22.02.03 23.02.03 23.02.03<br />
24.02.03 24.02.03 25.02.03 25.02.03 26.02.03 26.02.03 27.02.03<br />
0<br />
12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12 16 20 0 4 8 12<br />
Uhrzeit [UT]<br />
Abb. 8.2: Temperaturabweichungen vom jeweiligen Nachtmittel während fünf aufeinanderfolgender<br />
Messnächte im Februar <strong>2003</strong>, ergänzt durch die Tagesmessungen des K-Lidars. Die gestrichelten Linien<br />
deuten die nach unten laufenden Phasen der Temperaturvariationen an.<br />
In Abbildung 8.2 ist die bis jetzt längste zusammenhängende Messung der durchgängigen<br />
Temperaturprofile vom Februar <strong>2003</strong> zu sehen. Die Temperaturabweichungen vom Nachtmittel<br />
zeigen neben den mit der Höhe zunehmenden Amplituden auch starke Veränderungen der<br />
Wellenstruktur von Nacht zu Nacht. Die Tageslicht-Daten des K-Lidars ergänzen die Nachtmessungen<br />
beider Lidars und bestätigen den Eindruck der ständigen Anwesenheit von Wellen<br />
(s. Kap. 15). Es ist möglich, die mit der Zeit nach unten laufenden Phasen der sich nach oben<br />
44<br />
20<br />
16<br />
12<br />
8<br />
4<br />
0<br />
-4<br />
-8<br />
-12<br />
-16<br />
-20<br />
Temperaturabweichung vom Mittel [K]<br />
Temperatur [K]