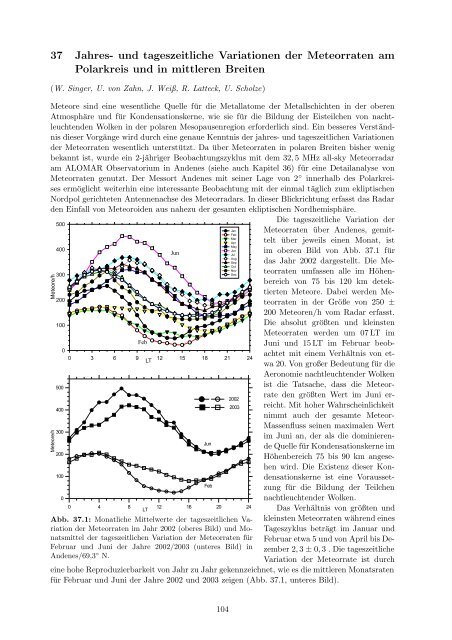Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
37 Jahres- und tageszeitliche Variationen der Meteorraten am<br />
Polarkreis und in mittleren Breiten<br />
(W. Singer, U. von Zahn, J. Weiß, R. Latteck, U. Scholze)<br />
Meteore sind eine wesentliche Quelle <strong>für</strong> die Metallatome der Metallschichten in der oberen<br />
Atmosphäre und <strong>für</strong> Kondensationskerne, wie sie <strong>für</strong> die Bildung der Eisteilchen von nachtleuchtenden<br />
Wolken in der polaren Mesopausenregion erforderlich sind. Ein besseres Verständnis<br />
dieser Vorgänge wird durch eine genaue Kenntnis der jahres- und tageszeitlichen Variationen<br />
der Meteorraten wesentlich unterstützt. Da über Meteorraten in polaren Breiten bisher wenig<br />
bekannt ist, wurde ein 2-jähriger Beobachtungszyklus mit dem 32, 5 MHz all-sky Meteorradar<br />
am ALOMAR Observatorium in Andenes (siehe auch Kapitel 36) <strong>für</strong> eine Detailanalyse von<br />
Meteorraten genutzt. Der Messort Andenes mit seiner Lage von 2 ◦ innerhalb des Polarkreises<br />
ermöglicht weiterhin eine interessante Beobachtung mit der einmal täglich zum ekliptischen<br />
Nordpol gerichteten Antennenachse des Meteorradars. In dieser Blickrichtung erfasst das Radar<br />
den Einfall von Meteoroiden aus nahezu der gesamten ekliptischen Nordhemisphäre.<br />
Abb. 37.1: Monatliche Mittelwerte der tageszeitlichen Variation<br />
der Meteorraten im Jahr <strong>2002</strong> (oberes Bild) und Monatsmittel<br />
der tageszeitlichen Variation der Meteorraten <strong>für</strong><br />
Februar und Juni der Jahre <strong>2002</strong>/<strong>2003</strong> (unteres Bild) in<br />
Andenes/69,3 ◦ N.<br />
Die tageszeitliche Variation der<br />
Meteorraten über Andenes, gemittelt<br />
über jeweils einen Monat, ist<br />
im oberen Bild von Abb. 37.1 <strong>für</strong><br />
das Jahr <strong>2002</strong> dargestellt. Die Meteorraten<br />
umfassen alle im Höhenbereich<br />
von 75 bis 120 km detektierten<br />
Meteore. Dabei werden Meteorraten<br />
in der Größe von 250 ±<br />
200 Meteoren/h vom Radar erfasst.<br />
Die absolut größten und kleinsten<br />
Meteorraten werden um 07 LT im<br />
Juni und 15 LT im Februar beobachtet<br />
mit einem Verhältnis von etwa<br />
20. Von großer Bedeutung <strong>für</strong> die<br />
Aeronomie nachtleuchtender Wolken<br />
ist die Tatsache, dass die Meteorrate<br />
den größten Wert im Juni erreicht.<br />
Mit hoher Wahrscheinlichkeit<br />
nimmt auch der gesamte Meteor-<br />
Massenfluss seinen maximalen Wert<br />
im Juni an, der als die dominierende<br />
Quelle <strong>für</strong> Kondensationskerne im<br />
Höhenbereich 75 bis 90 km angesehen<br />
wird. Die Existenz dieser Kondensationskerne<br />
ist eine Voraussetzung<br />
<strong>für</strong> die Bildung der Teilchen<br />
nachtleuchtender Wolken.<br />
Das Verhältnis von größten und<br />
kleinsten Meteorraten während eines<br />
Tageszyklus beträgt im Januar und<br />
Februar etwa 5 und von April bis Dezember<br />
2, 3 ± 0, 3 . Die tageszeitliche<br />
Variation der Meteorrate ist durch<br />
eine hohe Reproduzierbarkeit von Jahr zu Jahr gekennzeichnet, wie es die mittleren Monatsraten<br />
<strong>für</strong> Februar und Juni der Jahre <strong>2002</strong> und <strong>2003</strong> zeigen (Abb. 37.1, unteres Bild).<br />
104