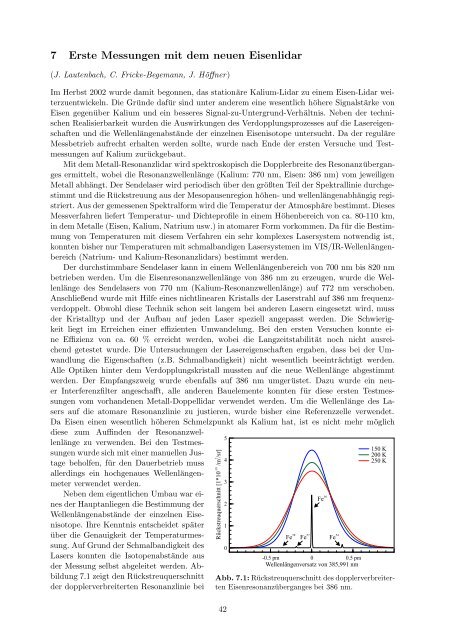Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
7 Erste Messungen mit dem neuen Eisenlidar<br />
(J. Lautenbach, C. Fricke-Begemann, J. Höffner)<br />
Im Herbst <strong>2002</strong> wurde damit begonnen, das stationäre Kalium-Lidar zu einem Eisen-Lidar weiterzuentwickeln.<br />
Die Gründe da<strong>für</strong> sind unter anderem eine wesentlich höhere Signalstärke von<br />
Eisen gegenüber Kalium und ein besseres Signal-zu-Untergrund-Verhältnis. Neben der technischen<br />
Realisierbarkeit wurden die Auswirkungen des Verdopplungsprozesses auf die Lasereigenschaften<br />
und die Wellenlängenabstände der einzelnen Eisenisotope untersucht. Da der reguläre<br />
Messbetrieb aufrecht erhalten werden sollte, wurde nach Ende der ersten Versuche und Testmessungen<br />
auf Kalium zurückgebaut.<br />
Mit dem Metall-Resonanzlidar wird spektroskopisch die Dopplerbreite des Resonanzüberganges<br />
ermittelt, wobei die Resonanzwellenlänge (Kalium: 770 nm, Eisen: 386 nm) vom jeweiligen<br />
Metall abhängt. Der Sendelaser wird periodisch über den größten Teil der Spektrallinie durchgestimmt<br />
und die Rückstreuung aus der Mesopausenregion höhen- und wellenlängenabhängig registriert.<br />
Aus der gemessenen Spektralform wird die Temperatur der Atmosphäre bestimmt. Dieses<br />
Messverfahren liefert Temperatur- und Dichteprofile in einem Höhenbereich von ca. 80-110 km,<br />
in dem Metalle (Eisen, Kalium, Natrium usw.) in atomarer Form vorkommen. Da <strong>für</strong> die Bestimmung<br />
von Temperaturen mit diesem Verfahren ein sehr komplexes Lasersystem notwendig ist,<br />
konnten bisher nur Temperaturen mit schmalbandigen Lasersystemen im VIS/IR-Wellenlängenbereich<br />
(Natrium- und Kalium-Resonanzlidars) bestimmt werden.<br />
Der durchstimmbare Sendelaser kann in einem Wellenlängenbereich von 700 nm bis 820 nm<br />
betrieben werden. Um die Eisenresonanzwellenlänge von 386 nm zu erzeugen, wurde die Wellenlänge<br />
des Sendelasers von 770 nm (Kalium-Resonanzwellenlänge) auf 772 nm verschoben.<br />
Anschließend wurde mit Hilfe eines nichtlinearen Kristalls der Laserstrahl auf 386 nm frequenzverdoppelt.<br />
Obwohl diese Technik schon seit langem bei anderen Lasern eingesetzt wird, muss<br />
der Kristalltyp und der Aufbau auf jeden Laser speziell angepasst werden. Die Schwierigkeit<br />
liegt im Erreichen einer effizienten Umwandelung. Bei den ersten Versuchen konnte eine<br />
Effizienz von ca. 60 % erreicht werden, wobei die Langzeitstabilität noch nicht ausreichend<br />
getestet wurde. Die Untersuchungen der Lasereigenschaften ergaben, dass bei der Umwandlung<br />
die Eigenschaften (z.B. Schmalbandigkeit) nicht wesentlich beeinträchtigt werden.<br />
Alle Optiken hinter dem Verdopplungskristall mussten auf die neue Wellenlänge abgestimmt<br />
werden. Der Empfangszweig wurde ebenfalls auf 386 nm umgerüstet. Dazu wurde ein neuer<br />
Interferenzfilter angeschafft, alle anderen Bauelemente konnten <strong>für</strong> diese ersten Testmessungen<br />
vom vorhandenen Metall-Doppellidar verwendet werden. Um die Wellenlänge des Lasers<br />
auf die atomare Resonanzlinie zu justieren, wurde bisher eine Referenzzelle verwendet.<br />
Da Eisen einen wesentlich höheren Schmelzpunkt als Kalium hat, ist es nicht mehr möglich<br />
diese zum Auffinden der Resonanzwellenlänge<br />
zu verwenden. Bei den Testmessungen<br />
wurde sich mit einer manuellen Justage<br />
beholfen, <strong>für</strong> den Dauerbetrieb muss<br />
allerdings ein hochgenaues Wellenlängenmeter<br />
verwendet werden.<br />
Neben dem eigentlichen Umbau war eines<br />
der Hauptanliegen die Bestimmung der<br />
Wellenlängenabstände der einzelnen Eisenisotope.<br />
Ihre Kenntnis entscheidet später<br />
über die Genauigkeit der Temperaturmessung.<br />
Auf Grund der Schmalbandigkeit des<br />
Lasers konnten die Isotopenabstände aus<br />
der Messung selbst abgeleitet werden. Abbildung<br />
7.1 zeigt den Rückstreuquerschnitt<br />
der dopplerverbreiterten Resonanzlinie bei<br />
-18 2<br />
Rückstreuquerschnitt [1*10 /m /sr]<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Fe 58<br />
Fe 57<br />
Fe 56<br />
Fe 54<br />
-0.5 pm<br />
0 0.5 pm<br />
Wellenlängenversatz von 385,991 nm<br />
150 K<br />
200 K<br />
250 K<br />
Abb. 7.1: Rückstreuquerschnitt des dopplerverbreiterten<br />
Eisenresonanzüberganges bei 386 nm.<br />
42