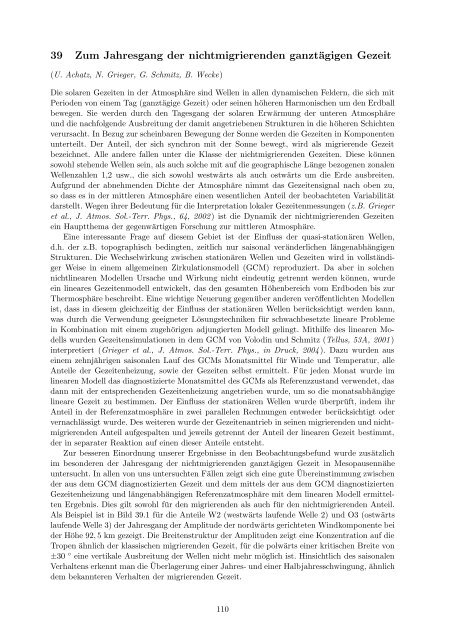Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
39 Zum Jahresgang der nichtmigrierenden ganztägigen Gezeit<br />
(U. Achatz, N. Grieger, G. Schmitz, B. Wecke)<br />
Die solaren Gezeiten in der Atmosphäre sind Wellen in allen dynamischen Feldern, die sich mit<br />
Perioden von einem Tag (ganztägige Gezeit) oder seinen höheren Harmonischen um den Erdball<br />
bewegen. Sie werden durch den Tagesgang der solaren Erwärmung der unteren Atmosphäre<br />
und die nachfolgende Ausbreitung der damit angetriebenen Strukturen in die höheren Schichten<br />
verursacht. In Bezug zur scheinbaren Bewegung der Sonne werden die Gezeiten in Komponenten<br />
unterteilt. Der Anteil, der sich synchron mit der Sonne bewegt, wird als migrierende Gezeit<br />
bezeichnet. Alle andere fallen unter die Klasse der nichtmigrierenden Gezeiten. Diese können<br />
sowohl stehende Wellen sein, als auch solche mit auf die geographische Länge bezogenen zonalen<br />
Wellenzahlen 1,2 usw., die sich sowohl westwärts als auch ostwärts um die Erde ausbreiten.<br />
Aufgrund der abnehmenden Dichte der Atmosphäre nimmt das Gezeitensignal nach oben zu,<br />
so dass es in der mittleren Atmosphäre einen wesentlichen Anteil der beobachteten Variabilität<br />
darstellt. Wegen ihrer Bedeutung <strong>für</strong> die Interpretation lokaler Gezeitenmessungen (z.B. Grieger<br />
et al., J. Atmos. Sol.-Terr. Phys., 64, <strong>2002</strong> ) ist die Dynamik der nichtmigrierenden Gezeiten<br />
ein Hauptthema der gegenwärtigen Forschung zur mittleren Atmosphäre.<br />
Eine interessante Frage auf diesem Gebiet ist der Einfluss der quasi-stationären Wellen,<br />
d.h. der z.B. topographisch bedingten, zeitlich nur saisonal veränderlichen längenabhängigen<br />
Strukturen. Die Wechselwirkung zwischen stationären Wellen und Gezeiten wird in vollständiger<br />
Weise in einem allgemeinen Zirkulationsmodell (GCM) reproduziert. Da aber in solchen<br />
nichtlinearen Modellen Ursache und Wirkung nicht eindeutig getrennt werden können, wurde<br />
ein lineares Gezeitenmodell entwickelt, das den gesamten Höhenbereich vom Erdboden bis zur<br />
Thermosphäre beschreibt. Eine wichtige Neuerung gegenüber anderen veröffentlichten Modellen<br />
ist, dass in diesem gleichzeitig der Einfluss der stationären Wellen berücksichtigt werden kann,<br />
was durch die Verwendung geeigneter Lösungstechniken <strong>für</strong> schwachbesetzte lineare Probleme<br />
in Kombination mit einem zugehörigen adjungierten Modell gelingt. Mithilfe des linearen Modells<br />
wurden Gezeitensimulationen in dem GCM von Volodin und Schmitz (Tellus, 53A, 2001 )<br />
interpretiert (Grieger et al., J. Atmos. Sol.-Terr. Phys., in Druck, 2004 ). Dazu wurden aus<br />
einem zehnjährigen saisonalen Lauf des GCMs Monatsmittel <strong>für</strong> Winde und Temperatur, alle<br />
Anteile der Gezeitenheizung, sowie der Gezeiten selbst ermittelt. Für jeden Monat wurde im<br />
linearen Modell das diagnostizierte Monatsmittel des GCMs als Referenzzustand verwendet, das<br />
dann mit der entsprechenden Gezeitenheizung angetrieben wurde, um so die monatsabhängige<br />
lineare Gezeit zu bestimmen. Der Einfluss der stationären Wellen wurde überprüft, indem ihr<br />
Anteil in der Referenzatmosphäre in zwei parallelen Rechnungen entweder berücksichtigt oder<br />
vernachlässigt wurde. Des weiteren wurde der Gezeitenantrieb in seinen migrierenden und nichtmigrierenden<br />
Anteil aufgespalten und jeweils getrennt der Anteil der linearen Gezeit bestimmt,<br />
der in separater Reaktion auf einen dieser Anteile entsteht.<br />
Zur besseren Einordnung unserer Ergebnisse in den Beobachtungsbefund wurde zusätzlich<br />
im besonderen der Jahresgang der nichtmigrierenden ganztägigen Gezeit in Mesopausennähe<br />
untersucht. In allen von uns untersuchten Fällen zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen<br />
der aus dem GCM diagnostizierten Gezeit und dem mittels der aus dem GCM diagnostizierten<br />
Gezeitenheizung und längenabhängigen Referenzatmosphäre mit dem linearen Modell ermittelten<br />
Ergebnis. Dies gilt sowohl <strong>für</strong> den migrierenden als auch <strong>für</strong> den nichtmigrierenden Anteil.<br />
Als Beispiel ist in Bild 39.1 <strong>für</strong> die Anteile W2 (westwärts laufende Welle 2) und O3 (ostwärts<br />
laufende Welle 3) der Jahresgang der Amplitude der nordwärts gerichteten Windkomponente bei<br />
der Höhe 92, 5 km gezeigt. Die Breitenstruktur der Amplituden zeigt eine Konzentration auf die<br />
Tropen ähnlich der klassischen migrierenden Gezeit, <strong>für</strong> die polwärts einer kritischen Breite von<br />
±30 ◦ eine vertikale Ausbreitung der Wellen nicht mehr möglich ist. Hinsichtlich des saisonalen<br />
Verhaltens erkennt man die Überlagerung einer Jahres- und einer Halbjahresschwingung, ähnlich<br />
dem bekannteren Verhalten der migrierenden Gezeit.<br />
110