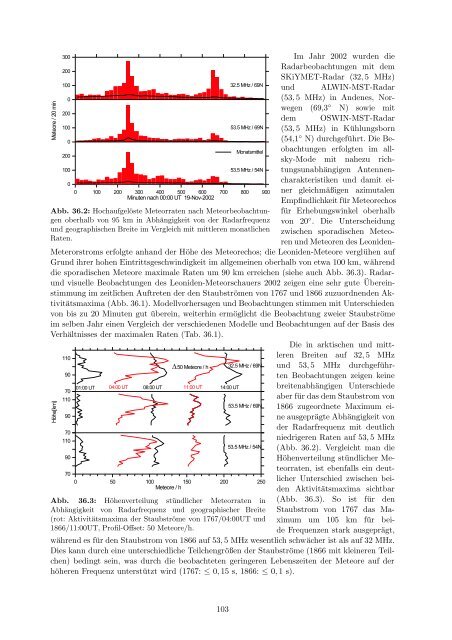Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Abb. 36.2: Hochaufgelöste Meteorraten nach Meteorbeobachtungen<br />
oberhalb von 95 km in Abhängigkeit von der Radarfrequenz<br />
und geographischen Breite im Vergleich mit mittleren monatlichen<br />
Raten.<br />
Im Jahr <strong>2002</strong> wurden die<br />
Radarbeobachtungen mit dem<br />
SKiYMET-Radar (32, 5 MHz)<br />
und ALWIN-MST-Radar<br />
(53, 5 MHz) in Andenes, Norwegen<br />
(69,3 ◦ N) sowie mit<br />
dem OSWIN-MST-Radar<br />
(53, 5 MHz) in Kühlungsborn<br />
(54,1 ◦ N) durchgeführt. Die Beobachtungen<br />
erfolgten im allsky-Mode<br />
mit nahezu richtungsunabhängigenAntennencharakteristiken<br />
und damit einer<br />
gleichmäßigen azimutalen<br />
Empfindlichkeit <strong>für</strong> Meteorechos<br />
<strong>für</strong> Erhebungswinkel oberhalb<br />
von 20 ◦ . Die Unterscheidung<br />
zwischen sporadischen Meteoren<br />
und Meteoren des Leoniden-<br />
Meterorstroms erfolgte anhand der Höhe des Meteorechos; die Leoniden-Meteore verglühen auf<br />
Grund ihrer hohen Eintrittsgeschwindigkeit im allgemeinen oberhalb von etwa 100 km, während<br />
die sporadischen Meteore maximale Raten um 90 km erreichen (siehe auch Abb. 36.3). Radarund<br />
visuelle Beobachtungen des Leoniden-Meteorschauers <strong>2002</strong> zeigen eine sehr gute Übereinstimmung<br />
im zeitlichen Auftreten der den Staubströmen von 1767 und 1866 zuzuordnenden Aktivitätsmaxima<br />
(Abb. 36.1). Modellvorhersagen und Beobachtungen stimmen mit Unterschieden<br />
von bis zu 20 Minuten gut überein, weiterhin ermöglicht die Beobachtung zweier Staubströme<br />
im selben Jahr einen Vergleich der verschiedenen Modelle und Beobachtungen auf der Basis des<br />
Verhältnisses der maximalen Raten (Tab. 36.1).<br />
Abb. 36.3: Höhenverteilung stündlicher Meteorraten in<br />
Abhängigkeit von Radarfrequenz und geographischer Breite<br />
(rot: Aktivitätsmaxima der Staubströme von 1767/04:00UT und<br />
1866/11:00UT, Profil-Offset: 50 Meteore/h.<br />
Die in arktischen und mittleren<br />
Breiten auf 32, 5 MHz<br />
und 53, 5 MHz durchgeführten<br />
Beobachtungen zeigen keine<br />
breitenabhängigen Unterschiede<br />
aber <strong>für</strong> das dem Staubstrom von<br />
1866 zugeordnete Maximum eine<br />
ausgeprägte Abhängigkeit von<br />
der Radarfrequenz mit deutlich<br />
niedrigeren Raten auf 53, 5 MHz<br />
(Abb. 36.2). Vergleicht man die<br />
Höhenverteilung stündlicher Meteorraten,<br />
ist ebenfalls ein deutlicher<br />
Unterschied zwischen beiden<br />
Aktivitätsmaxima sichtbar<br />
(Abb. 36.3). So ist <strong>für</strong> den<br />
Staubstrom von 1767 das Maximum<br />
um 105 km <strong>für</strong> beide<br />
Frequenzen stark ausgeprägt,<br />
während es <strong>für</strong> den Staubstrom von 1866 auf 53, 5 MHz wesentlich schwächer ist als auf 32 MHz.<br />
Dies kann durch eine unterschiedliche Teilchengrößen der Staubströme (1866 mit kleineren Teilchen)<br />
bedingt sein, was durch die beobachteten geringeren Lebenszeiten der Meteore auf der<br />
höheren Frequenz unterstützt wird (1767: ≤ 0, 15 s, 1866: ≤ 0, 1 s).<br />
103