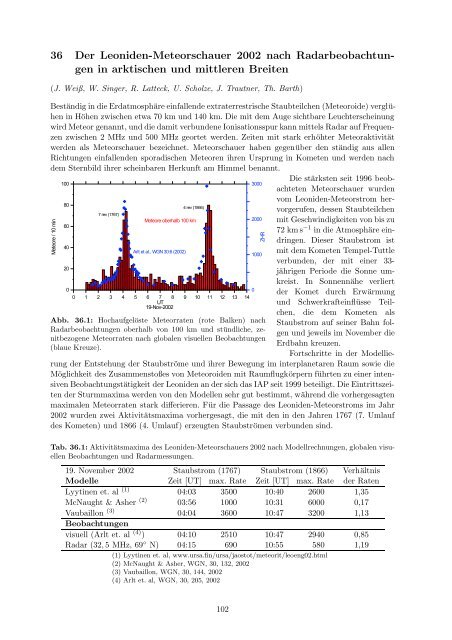Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
36 Der Leoniden-Meteorschauer <strong>2002</strong> nach Radarbeobachtungen<br />
in arktischen und mittleren Breiten<br />
(J. Weiß, W. Singer, R. Latteck, U. Scholze, J. Trautner, Th. Barth)<br />
Beständig in die Erdatmosphäre einfallende extraterrestrische Staubteilchen (Meteoroide) verglühen<br />
in Höhen zwischen etwa 70 km und 140 km. Die mit dem Auge sichtbare Leuchterscheinung<br />
wird Meteor genannt, und die damit verbundene Ionisationsspur kann mittels Radar auf Frequenzen<br />
zwischen 2 MHz und 500 MHz geortet werden. Zeiten mit stark erhöhter Meteoraktivität<br />
werden als Meteorschauer bezeichnet. Meteorschauer haben gegenüber den ständig aus allen<br />
Richtungen einfallenden sporadischen Meteoren ihren Ursprung in Kometen und werden nach<br />
dem Sternbild ihrer scheinbaren Herkunft am Himmel benannt.<br />
Abb. 36.1: Hochaufgelöste Meteorraten (rote Balken) nach<br />
Radarbeobachtungen oberhalb von 100 km und stündliche, zenitbezogene<br />
Meteorraten nach globalen visuellen Beobachtungen<br />
(blaue Kreuze).<br />
Die stärksten seit 1996 beobachteten<br />
Meteorschauer wurden<br />
vom Leoniden-Meteorstrom hervorgerufen,<br />
dessen Staubteilchen<br />
mit Geschwindigkeiten von bis zu<br />
72 km s −1 in die Atmosphäre eindringen.<br />
Dieser Staubstrom ist<br />
mit dem Kometen Tempel-Tuttle<br />
verbunden, der mit einer 33jährigen<br />
Periode die Sonne umkreist.<br />
In Sonnennähe verliert<br />
der Komet durch Erwärmung<br />
und Schwerkrafteinflüsse Teilchen,<br />
die dem Kometen als<br />
Staubstrom auf seiner Bahn folgen<br />
und jeweils im November die<br />
Erdbahn kreuzen.<br />
Fortschritte in der Modellie-<br />
rung der Entstehung der Staubströme und ihrer Bewegung im interplanetaren Raum sowie die<br />
Möglichkeit des Zusammenstoßes von Meteoroiden mit Raumflugkörpern führten zu einer intensiven<br />
Beobachtungstätigkeit der Leoniden an der sich das IAP seit 1999 beteiligt. Die Eintrittszeiten<br />
der Sturmmaxima werden von den Modellen sehr gut bestimmt, während die vorhergesagten<br />
maximalen Meteorraten stark differieren. Für die Passage des Leoniden-Meteorstroms im Jahr<br />
<strong>2002</strong> wurden zwei Aktivitätsmaxima vorhergesagt, die mit den in den Jahren 1767 (7. Umlauf<br />
des Kometen) und 1866 (4. Umlauf) erzeugten Staubströmen verbunden sind.<br />
Tab. 36.1: Aktivitätsmaxima des Leoniden-Meteorschauers <strong>2002</strong> nach Modellrechnungen, globalen visuellen<br />
Beobachtungen und Radarmessungen.<br />
19. November <strong>2002</strong> Staubstrom (1767) Staubstrom (1866) Verhältnis<br />
Modelle Zeit [UT] max. Rate Zeit [UT] max. Rate der Raten<br />
Lyytinen et. al (1) 04:03 3500 10:40 2600 1,35<br />
McNaught & Asher (2) 03:56 1000 10:31 6000 0,17<br />
Vaubaillon (3) 04:04 3600 10:47 3200 1,13<br />
Beobachtungen<br />
visuell (Arlt et. al (4) ) 04:10 2510 10:47 2940 0,85<br />
Radar (32, 5 MHz, 69 ◦ N) 04:15 690 10:55 580 1,19<br />
(1) Lyytinen et. al, www.ursa.fin/ursa/jaostot/meteorit/leoeng02.html<br />
(2) McNaught & Asher, WGN, 30, 132, <strong>2002</strong><br />
(3) Vaubaillon, WGN, 30, 144, <strong>2002</strong><br />
(4) Arlt et. al, WGN, 30, 205, <strong>2002</strong><br />
102