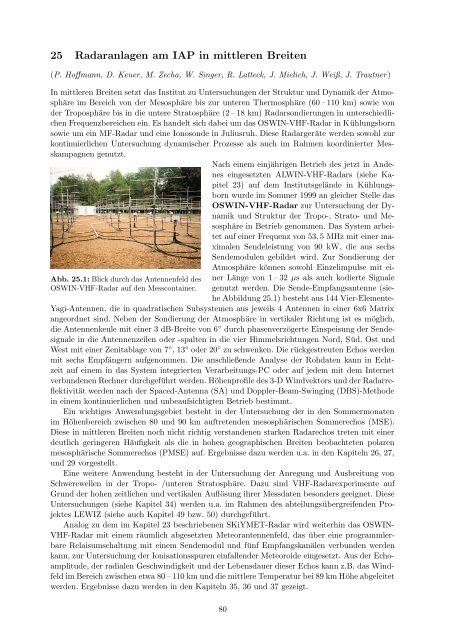Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2002/2003 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
25 Radaranlagen am IAP in mittleren Breiten<br />
(P. Hoffmann, D. Keuer, M. Zecha, W. Singer, R. Latteck, J. Mielich, J. Weiß, J. Trautner)<br />
In mittleren Breiten setzt das <strong>Institut</strong> zu Untersuchungen der Struktur und Dynamik der Atmosphäre<br />
im Bereich von der Mesosphäre bis zur unteren Thermosphäre (60 – 110 km) sowie von<br />
der Troposphäre bis in die untere Stratosphäre (2 – 18 km) Radarsondierungen in unterschiedlichen<br />
Frequenzbereichen ein. Es handelt sich dabei um das OSWIN-VHF-Radar in Kühlungsborn<br />
sowie um ein MF-Radar und eine Ionosonde in Juliusruh. Diese Radargeräte werden sowohl zur<br />
kontinuierlichen Untersuchung dynamischer Prozesse als auch im Rahmen koordinierter Mes-<br />
skampagnen genutzt.<br />
Abb. 25.1: Blick durch das Antennenfeld des<br />
OSWIN-VHF-Radar auf den Messcontainer.<br />
Nach einem einjährigen Betrieb des jetzt in Andenes<br />
eingesetzten ALWIN-VHF-Radars (siehe Kapitel<br />
23) auf dem <strong>Institut</strong>sgelände in Kühlungsborn<br />
wurde im Sommer 1999 an gleicher Stelle das<br />
OSWIN-VHF-Radar zur Untersuchung der Dynamik<br />
und Struktur der Tropo-, Strato- und Mesosphäre<br />
in Betrieb genommen. Das System arbeitet<br />
auf einer Frequenz von 53, 5 MHz mit einer maximalen<br />
Sendeleistung von 90 kW, die aus sechs<br />
Sendemodulen gebildet wird. Zur Sondierung der<br />
Atmosphäre können sowohl Einzelimpulse mit einer<br />
Länge von 1 – 32 µs als auch kodierte Signale<br />
genutzt werden. Die Sende-Empfangsantenne (siehe<br />
Abbildung 25.1) besteht aus 144 Vier-Elemente-<br />
Yagi-Antennen, die in quadratischen Subsystemen aus jeweils 4 Antennen in einer 6x6 Matrix<br />
angeordnet sind. Neben der Sondierung der Atmosphäre in vertikaler Richtung ist es möglich,<br />
die Antennenkeule mit einer 3 dB-Breite von 6 ◦ durch phasenverzögerte Einspeisung der Sendesignale<br />
in die Antennenzeilen oder -spalten in die vier Himmelsrichtungen Nord, Süd, Ost und<br />
West mit einer Zenitablage von 7 ◦ , 13 ◦ oder 20 ◦ zu schwenken. Die rückgestreuten Echos werden<br />
mit sechs Empfängern aufgenommen. Die anschließende Analyse der Rohdaten kann in Echtzeit<br />
auf einem in das System integrierten Verarbeitungs-PC oder auf jedem mit dem Internet<br />
verbundenen Rechner durchgeführt werden. Höhenprofile des 3-D Windvektors und der Radarreflektivität<br />
werden nach der Spaced-Antenna (SA) und Doppler-Beam-Swinging (DBS)-Methode<br />
in einem kontinuierlichen und unbeaufsichtigten Betrieb bestimmt.<br />
Ein wichtiges Anwendungsgebiet besteht in der Untersuchung der in den Sommermonaten<br />
im Höhenbereich zwischen 80 und 90 km auftretenden mesosphärischen Sommerechos (MSE).<br />
Diese in mittleren Breiten noch nicht richtig verstandenen starken Radarechos treten mit einer<br />
deutlich geringeren Häufigkeit als die in hohen geographischen Breiten beobachteten polaren<br />
mesosphärische Sommerechos (PMSE) auf. Ergebnisse dazu werden u.a. in den Kapiteln 26, 27,<br />
und 29 vorgestellt.<br />
Eine weitere Anwendung besteht in der Untersuchung der Anregung und Ausbreitung von<br />
Schwerewellen in der Tropo- /unteren Stratosphäre. Dazu sind VHF-Radarexperimente auf<br />
Grund der hohen zeitlichen und vertikalen Auflösung ihrer Messdaten besonders geeignet. Diese<br />
Untersuchungen (siehe Kapitel 34) werden u.a. im Rahmen des abteilungsübergreifenden Projektes<br />
LEWIZ (siehe auch Kapitel 49 bzw. 50) durchgeführt.<br />
Analog zu dem im Kapitel 23 beschriebenen SKiYMET-Radar wird weiterhin das OSWIN-<br />
VHF-Radar mit einem räumlich abgesetzten Meteorantennenfeld, das über eine programmierbare<br />
Relaisumschaltung mit einem Sendemodul und fünf Empfangskanälen verbunden werden<br />
kann, zur Untersuchung der Ionisationsspuren einfallender Meteoroide eingesetzt. Aus der Echoamplitude,<br />
der radialen Geschwindigkeit und der Lebensdauer dieser Echos kann z.B. das Windfeld<br />
im Bereich zwischen etwa 80 – 110 km und die mittlere Temperatur bei 89 km Höhe abgeleitet<br />
werden. Ergebnisse dazu werden in den Kapiteln 35, 36 und 37 gezeigt.<br />
80