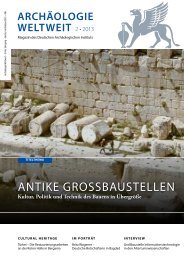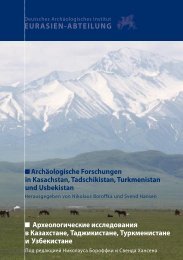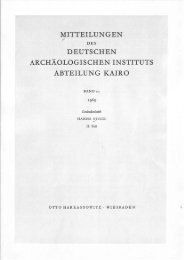- Seite 1 und 2:
FORSCHUNGSPLAN DES DEUTSCHEN ARCHÄ
- Seite 3 und 4:
B SPEZIELLER TEIL .................
- Seite 5 und 6:
B VI Abteilung Athen ..............
- Seite 7 und 8:
B XI Abteilung Kairo ..............
- Seite 9 und 10:
und Archiv) stärker in wissenschaf
- Seite 11 und 12:
A ALLGEMEINER TEIL Forschungsplan S
- Seite 13 und 14:
4 Räume von Macht und Repräsentat
- Seite 15 und 16:
is zur Neuzeit im gesamten Arbeitsb
- Seite 17 und 18:
und Akkulturation und die Frage, in
- Seite 19 und 20:
angrenzenden Regionen aus, so u. a.
- Seite 21 und 22:
schungsprojekten auf allen fünf Ko
- Seite 23 und 24:
e) Grundlagenforschungen zur antike
- Seite 25 und 26:
2) Forschungsschwerpunkte Die Arbei
- Seite 27 und 28:
- DFG-SPP „Frühe Zentralisierung
- Seite 29 und 30:
Kommission für Alte Geschichte und
- Seite 31 und 32:
noch nie übergreifend behandelt wo
- Seite 33 und 34:
2) Forschungsschwerpunkte Die Proje
- Seite 35 und 36:
Die Ausgrabungen werden sich in den
- Seite 37 und 38:
Abteilung Rom 1) Vorbemerkung Die A
- Seite 39 und 40:
Fragen der Urbanität haben auf der
- Seite 41 und 42:
gebundenen Kollegen betrieben werde
- Seite 43 und 44:
- Die archaische Stadt von Milet (R
- Seite 45 und 46:
Abteilung Istanbul 1) Vorbemerkung
- Seite 47 und 48:
Trotz aufwendiger Befestigungsanlag
- Seite 49 und 50:
Abteilung Madrid 1) Vorbemerkung De
- Seite 51 und 52:
kontinentale Wege, hier begegnen fr
- Seite 53 und 54:
- Studien zu iberischen und griechi
- Seite 55 und 56:
Orient-Abteilung 1) Vorbemerkung Da
- Seite 57 und 58:
Sesshaftigkeit kennzeichnet keinesw
- Seite 59 und 60:
gen/Forschungscluster C2) sowie Sü
- Seite 61 und 62:
Eurasien-Abteilung 1) Vorbemerkung
- Seite 63 und 64:
kohlenstoffdaten vorliegen, d.h. vo
- Seite 65 und 66:
) Regionale Schwerpunkte Die Bildun
- Seite 67 und 68:
- Ausgrabungen im Siedlungshügel A
- Seite 69 und 70:
- Ordosbronzen Ausstellung und Kata
- Seite 71 und 72:
sind. Gerade solche groß angelegte
- Seite 73 und 74:
antiker Siedlung, die Verlagerung d
- Seite 75 und 76:
Wesentlich wird dabei der Blick üb
- Seite 77 und 78:
Orientierungen, Selbst- und Weltbil
- Seite 79 und 80:
Sache. Die großen Siedlungsgrabung
- Seite 81 und 82:
ial zielender wissenschaftshistoris
- Seite 83 und 84:
B I Wissenschaftliche Abteilung der
- Seite 85 und 86:
� Veronica Bucciantini d) Olympia
- Seite 87 und 88:
Integration der östlichen Gefäßt
- Seite 89 und 90:
Projektlaufzeit � 2004-2011 Betre
- Seite 91 und 92:
zwei Wellen im Verlaufe des 6.- 5.
- Seite 93 und 94:
Projektlaufzeit � 2008-2011 Betre
- Seite 95 und 96:
Siedlungen im Umfeld des Palastes g
- Seite 97 und 98:
Zusammenhang nordarabischer Siedlun
- Seite 99 und 100:
Weiterhin ungeklärte bauliche Deta
- Seite 101 und 102:
günstigen archäologischen Vorauss
- Seite 103 und 104:
Errichtung und Bearbeitung von Temp
- Seite 105 und 106:
Projektlaufzeit � Bis 2010 Betreu
- Seite 107 und 108:
4) IT-Kompetenzzentrum für die Arc
- Seite 109 und 110:
sollen möglichst im Open Access so
- Seite 111 und 112:
Kooperationspartner � Prof. Dr. R
- Seite 113 und 114:
Projektlaufzeit � Erstbetrieb bis
- Seite 115 und 116:
Wissenschaftliche Perspektiven �
- Seite 117 und 118:
Betreuung � Dr. Monika Linder �
- Seite 119 und 120:
den - ein wesentlicher Beitrag zum
- Seite 121 und 122:
Seit 2006 werden Bau, Ausstattung u
- Seite 123 und 124:
aufweisen. Drei bautypologisch unte
- Seite 125 und 126:
Betreuung � Prof. Dr. Norbert Ben
- Seite 127 und 128:
Der Ausbau und die Pflege regionale
- Seite 129 und 130:
) Der mehrperiodige Fundplatz von W
- Seite 131 und 132:
nen Einfluss auf die Landschaft und
- Seite 133 und 134:
Kooperationspartner � Prof. Dr. H
- Seite 135 und 136:
) Choregische Weihgeschenke und ver
- Seite 137 und 138:
Kooperationspartner � Dr. Oliver
- Seite 139 und 140:
Kooperationspartner � Prof. Dr. A
- Seite 141 und 142:
B II Römisch-Germanische Kommissio
- Seite 143 und 144:
len möglichst in Form eines Aufsat
- Seite 145 und 146:
neuen wiss. Hilfskraft soll diese d
- Seite 147 und 148:
� Universität Alcalá de Henares
- Seite 149 und 150:
3) Pergamon und Attalidenreich: Ins
- Seite 151 und 152:
deutung. Die ca. 3500 bisher gesamm
- Seite 153 und 154:
Kooperationspartner � Deutsches B
- Seite 155 und 156:
Kooperationspartner � DAI Madrid
- Seite 157 und 158:
schen Dokumentation, aber auch unte
- Seite 159 und 160:
Betreuung � Mag. phil. Roland Fä
- Seite 161 und 162:
B IV Kommission für Archäologie A
- Seite 163 und 164:
lungstechnik, Altersstellung) wicht
- Seite 165 und 166:
3) Anden-Transekt 2: Die Besiedlung
- Seite 167 und 168:
Betreuung � Prof. Dr. H.-G. Hütt
- Seite 169 und 170:
In den nächsten fünf Jahren steht
- Seite 171 und 172:
der Fundschicht und auch in der Mus
- Seite 173 und 174:
Wissenschaftliche Perspektiven �
- Seite 175 und 176:
Wissenschaftliche Perspektiven �
- Seite 177 und 178:
Kooperationspartner � Soprintende
- Seite 179 und 180:
) Indigene Siedlungen in Unteritali
- Seite 181 und 182:
punischen und später römischen Ku
- Seite 183 und 184:
Vorstellung zu gewinnen. Dort wurde
- Seite 185 und 186:
fehlen aber gänzlich. Aus diesem G
- Seite 187 und 188:
die im Museo Nazionale Romano (Term
- Seite 189 und 190:
zweiten Hälfte des 1. Jhs., die zu
- Seite 191 und 192:
2) Untersuchungen zur Spolienverwer
- Seite 193 und 194:
5) Das "Villino Amelung" in Rom: vo
- Seite 195 und 196:
Wissenschaftliche Perspektive � A
- Seite 197 und 198:
(kirchen-)politischen Lage und der
- Seite 199 und 200:
) Nordafrika-Browser Der komplexe N
- Seite 201 und 202:
B VI Abteilung Athen 1 Forschungssc
- Seite 203 und 204:
exportiert wurde. Lokal hergestellt
- Seite 205 und 206:
gen zielstrebig fortgesetzt und dur
- Seite 207 und 208:
der Veränderung der Bedeutung und
- Seite 209 und 210:
als die vielen kleineren Städte de
- Seite 211 und 212:
� Türkischer Antikendienst Finan
- Seite 213 und 214:
Kooperationspartner � Griechische
- Seite 215 und 216:
e) Milet, Heiligtümer der archaisc
- Seite 217 und 218:
tischen Aristokratie der archaische
- Seite 219 und 220:
Fresken des Jahres 1910, die in dem
- Seite 221 und 222:
3) Töpferproduktion im Kerameikos
- Seite 223 und 224:
ten Tonwannen nicht nachweisen. Vie
- Seite 225 und 226: europäischen Einstellungen und her
- Seite 227 und 228: Rahmen der Konferenz der EfA Athen
- Seite 229 und 230: ehandelt werden. Konkreter Forschun
- Seite 231 und 232: � Grabungsprojekt Sirkeli Höyük
- Seite 233 und 234: te bleibt bislang der geometrische
- Seite 235 und 236: durch Bauaufnahmen, Siedlungskartie
- Seite 237 und 238: extraurbanen Heiligtümern soll dis
- Seite 239 und 240: Wissenschaftliche Perspektiven �
- Seite 241 und 242: ende Perspektiven für die Analyse
- Seite 243 und 244: den sollen. Hier sind in den Jahren
- Seite 245 und 246: Neben der Fortführung und dem Absc
- Seite 247 und 248: Über die archäologisch-epigraphis
- Seite 249 und 250: Neuerungen, Charakteristika in Devo
- Seite 251 und 252: au in Zentralanatolien, sind bislan
- Seite 253 und 254: Finanzierung � DAI b) Wissenschaf
- Seite 255 und 256: Andererseits zeigen die Befunde ein
- Seite 257 und 258: B VIII Abteilung Madrid 1 Forschung
- Seite 259 und 260: ) Phönizische und Punische ‚Kolo
- Seite 261 und 262: äumliche Einheit, die als solche z
- Seite 263 und 264: c 2) Monte do Facho/Cangas de Morra
- Seite 265 und 266: c 4) Panóias/ Vila Real (Portugal)
- Seite 267 und 268: den. Die in ar-Rumaniya gewonnenen
- Seite 269 und 270: � A. J. Kalis, A. Stobbe, Univers
- Seite 271 und 272: griechischen Polis Emporion/Emporia
- Seite 273 und 274: gebracht. Herauszuarbeiten ist der
- Seite 275: Projektlaufzeit � 2006-2010 Betre
- Seite 279 und 280: Nach den 2008 vorgenommenen Aufnahm
- Seite 281 und 282: führung der Bauarbeiten wurde ält
- Seite 283 und 284: Mittelpunkt, das in Toledo angesich
- Seite 285 und 286: � P. Sada, Museu Nacional d'Arque
- Seite 287 und 288: B IX Orient-Abteilung 1 Forschungss
- Seite 289 und 290: Basierend auf den Ergebnissen des v
- Seite 291 und 292: In den ariden Wüstenrandgebieten S
- Seite 293 und 294: Dringlichkeit der Aufnahme von offi
- Seite 295 und 296: er zu erforschen, um somit einen we
- Seite 297 und 298: im Bereich des Wadi Ğufaina für d
- Seite 299 und 300: Universität in Khuraybah/Dedan) da
- Seite 301 und 302: eleuchtet und eine bauhistorische D
- Seite 303 und 304: Projektlaufzeit � 2007-2013 Betre
- Seite 305 und 306: Wissenschaftliche Perspektiven �
- Seite 307 und 308: Verschiedene Beispiele dieser Baute
- Seite 309 und 310: mationen zum Wandel der Bestattungs
- Seite 311 und 312: Wandgestaltung als Hinweis auf eine
- Seite 313 und 314: und des Kulturtransfers zwischen S
- Seite 315 und 316: Im Rahmen des Exzellenzclusters TOP
- Seite 317 und 318: B X Eurasien-Abteilung 1 Einzel- un
- Seite 319 und 320: � M. Özdoğan/ H. Parzinger/ H.
- Seite 321 und 322: Wissenschaftliche Perspektiven �
- Seite 323 und 324: Literatur � T. Kiguradze, Neolith
- Seite 325 und 326: nig nachgewiesen; Gründe für dies
- Seite 327 und 328:
Möglicherweise handelt es sich bei
- Seite 329 und 330:
Die These einer erstmals in Varna g
- Seite 331 und 332:
chäologischen Museum in Kišinev k
- Seite 333 und 334:
� B. Helwing, Winckelmann-Feier 2
- Seite 335 und 336:
Publikationen � U. Franke-Vogt, E
- Seite 337 und 338:
Berliner Gesellschaft für Anthropo
- Seite 339 und 340:
Mit diesem Projekt wird die Frage n
- Seite 341 und 342:
i) Paläopathologische Untersuchung
- Seite 343 und 344:
nach wie vor seiner Rolle als Kultu
- Seite 345 und 346:
Betreuung � Dr. Udo Schlotzhauer
- Seite 347 und 348:
Projektlaufzeit � abgeschlossen;
- Seite 349 und 350:
unde, mit Türmen bewehrte, Anlage
- Seite 351 und 352:
untersucht werden sollen. Da das Ar
- Seite 353 und 354:
ob die Straßen hier der gebaute We
- Seite 355 und 356:
c) Projekt Pănade, Rumänien In de
- Seite 357 und 358:
sonderen Gestaltung des zentralen B
- Seite 359 und 360:
Publikationen � S. Reinhold/ D. S
- Seite 361 und 362:
Finanzierung � Auswärtiges Amt a
- Seite 363 und 364:
der über mindestens eine Treppe un
- Seite 365 und 366:
� Frau Dr. M. Müller-Wiener, Sem
- Seite 367 und 368:
die meisten von ihnen nicht dokumen
- Seite 369 und 370:
und Siedlungen und sonstigen Monume
- Seite 371 und 372:
Ziel des Aga Khan Trust for Culture
- Seite 373 und 374:
e) Untersuchungen zur Drehscheibenk
- Seite 375 und 376:
Publikation � Wieczorek/ Chr. Lin
- Seite 377 und 378:
Betreuung � PD Dr. Mayke Wagner k
- Seite 379 und 380:
lung. Zu den Konstanten gehört som
- Seite 381 und 382:
2) Lebenswelten Die Fragen nach den
- Seite 383 und 384:
Workshop „The First Cataract - On
- Seite 385 und 386:
jüngste Neuzeit die Veränderung d
- Seite 387 und 388:
Wissenschaftliche Perspektive � I
- Seite 389 und 390:
- Analyse des urbanistischen Muster
- Seite 391 und 392:
Zeit in dem spät-ramessidischen Pa
- Seite 393 und 394:
wird zum „Subjekt der Gottesvereh
- Seite 395 und 396:
chen Nebengräbern, in denen wahrsc
- Seite 397 und 398:
Der Schwerpunkt der Belegung des Fr
- Seite 399 und 400:
Wissenschaftliche Perspektiven �
- Seite 401 und 402:
eichenden beschrifteten Objekte wir
- Seite 403 und 404:
sich die bisher großenteils unbeka
- Seite 405 und 406:
� Dr. Nicole Alexanian � Prof.
- Seite 407 und 408:
eitragen. Zu erwarten sind dabei ne
- Seite 409 und 410:
� Durch die zahlreichen späteren
- Seite 411 und 412:
� Mit diesen Befunden bietet Maad
- Seite 413 und 414:
gruppen aus der südlichen Levante.
- Seite 415 und 416:
großen Friedhof gehören, der in d
- Seite 417 und 418:
gemeinen kulturellen und politische
- Seite 419 und 420:
- Beschreibung des aktuellen Zustan
- Seite 421 und 422:
konkretisieren und besser zu verste
- Seite 423 und 424:
Beziehungen bestätigt und zu der V
- Seite 425 und 426:
der Vierkonchenkirche wurde auch di
- Seite 427 und 428:
heidnischen Vorgängersiedlung geh
- Seite 429 und 430:
Kupfer- oder Malachitfunden mit bek
- Seite 431 und 432:
menhang mit der industriellen Revol
- Seite 433 und 434:
Gleichzeitig sollen die im Zuge der
- Seite 435 und 436:
Einerseits werden aufgrund von Lite
- Seite 437 und 438:
Die zweite Besonderheit besteht dar
- Seite 439 und 440:
wicklung sowie die diesbezügliche
- Seite 441 und 442:
Erman- Nachlasses in Bremen und dem