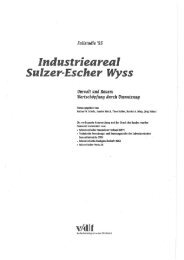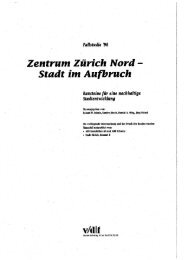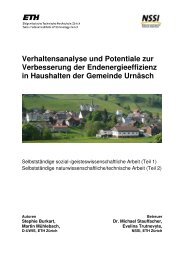Appenzell Ausserrhoden - ETH Zurich - Natural and Social Science ...
Appenzell Ausserrhoden - ETH Zurich - Natural and Social Science ...
Appenzell Ausserrhoden - ETH Zurich - Natural and Social Science ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Appenzell</strong>er Textilindustrie<br />
4 Varianten und Szenarien<br />
Varianten beschreiben Entwicklungen bzw. zukünftige<br />
Zustände eines Systems. In unserem Fall bedeutet das die<br />
Beschreibung möglicher Entwicklungen, welche die <strong>Appenzell</strong>er<br />
Textilbetriebe in den kommenden 20 Jahren<br />
nehmen könnten. Eine Variante resultiert dabei aus der<br />
Kombination der Ausprägungen der (internen) Systemgrössen.<br />
Ein Szenario entsteht prinzipiell gleich, mit dem<br />
Unterschied, dass es sich um Einflussfaktoren h<strong>and</strong>elt, deren<br />
Ausprägungen kombiniert werden, und dass es sich<br />
um eine hypothetische, vom System nicht beeinflussbare<br />
äussere Entwicklung h<strong>and</strong>elt.<br />
Für die formative wie die intuitive Varianten- und Szenariokonstruktion<br />
wurden die Erkenntnisse aus der Systemanalyse<br />
eingebracht. Jede der intuitiv entst<strong>and</strong>enen<br />
Varianten wurde anschliessend in die Sprache der Systemgrössen<br />
aus der formativen Szenarioanalyse (s. Kap.<br />
3.6) übersetzt, sodass nach Durchführung der Konsistenzanalyse<br />
jeder intuitiv erarbeiteten Variante die entsprechende<br />
Systemgrössen-Ausprägungs-Kombination des<br />
formativen Verfahrens zugewiesen werden konnte. Somit<br />
wurden vier konkrete Varianten aus beiden methodischen<br />
Wegen synthetisiert, die im Folgenden dargelegt werden<br />
(s. Kap. 4.1). In einem zweiten Abschnitt werden die vier<br />
nach gleichem Verfahren wie die Varianten entst<strong>and</strong>enen<br />
(Rahmen-) Szenarien skizziert (s. Kap. 4.2). Im dritten<br />
Abschnitt (s. Kap. 4.3) werden die Varianten auf ihre<br />
Verträglichkeit bezüglich äusseren Rahmenbedingungen<br />
überprüft (Robustheitsanalyse).<br />
4.1 Varianten<br />
Zur Übersicht seien hier die Ausprägungskombinationen<br />
der Systemgrössen für die vier Varianten dargestellt (s.<br />
Tab. 4.1). Gleichzeitig sind den Ausprägungen Werte zugeordnet,<br />
welche die Unterschiede zwischen den Varianten<br />
quantitativ verdeutlichen.<br />
In den nachfolgenden Abschnitten werden die vier Varianten,<br />
basierend auf den in Tabelle 4.1 dargestellten Informationen,<br />
detailliert beschrieben.<br />
4.1.1 Variante: Minimale Kooperation<br />
Die wirtschaftliche Unabhängigkeit<br />
der Einzelbetriebe<br />
wird, mit all ihren positiven<br />
und negativen Begleiterscheinungen,<br />
aufrechterhalten.<br />
Dies verhindert die Bereitschaft<br />
zu intensiveren Kooperationen<br />
zwischen den einzelnen<br />
Betrieben und hat eine dezentrale<br />
Produktion zu Folge.<br />
Da bei gleichbleibenden Strukturen keine zusätzlichen<br />
Erträge zu erwarten sind, bleibt die Investitionspolitik der<br />
Unternehmen tief, d.h. bei weniger als 5% des Umsatzes.<br />
Investitionen im Bereich Umwelt bleiben gleich oder<br />
nehmen sogar ab. Durch ein hohes Mass an Selbständigkeit<br />
bleiben die Firmen von einer hohen Verschuldung<br />
verschont.<br />
Der regionale Personalbest<strong>and</strong> im textilen Sektor wird<br />
weiterhin rückläufig sein; die Schulungsangebote nehmen<br />
betriebsextern ab und müssen vorwiegend intern gestaltet<br />
werden. Somit werden im Rahmen dieser Variante 75%<br />
der Ausbildungszeit betriebsintern abgewickelt.<br />
Die Arbeitsplatzqualität bleibt im Vergleich mit <strong>and</strong>eren<br />
Wirtschaftszweigen schlecht, denn nur 30% der Stellen<br />
fordern hohe Anforderungen an den Mitarbeitenden;<br />
entsprechend sind die zu erwartenden Durchschnittslöhne<br />
niedrig.<br />
Die Betriebe werden mehrheitlich familiär geführt, was<br />
zur Folge hat, dass zwar flache Strukturen mit lediglich 3<br />
bis 7 Strukturebenen vorherrschen, jedoch durchaus auch<br />
hierarchische Managementprozesse in einigen Betrieben<br />
auftreten. Die aktuellen Strukturen und Vorgehensweisen<br />
des Systems werden beibehalten; es bleibt somit reaktiv<br />
statt pro-aktiv, und externe Faktoren bleiben mit ihren positiven<br />
und negativen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit<br />
und Konkurrenzfähigkeit der Einzelbetriebe entscheidend.<br />
Die H<strong>and</strong>habung der Ressourcen bleibt weitgehend den<br />
einzelnen Unternehmen überlassen, wodurch Skaleneffekte<br />
entstehen (zur Herstellung einer Einheit eines Produktes<br />
braucht es fast gleichviel Ressourcen wie zur Herstellung<br />
von 1000 Einheiten, da das Gros der Ressourcen<br />
zur Betreibung der Maschinen verwendet wird; somit<br />
sinkt der Ressourcenaufw<strong>and</strong> pro Einheit mit jeder zusätzlich<br />
produzierten) und Entwicklungen zur effektiveren<br />
Ressourcennutzung nicht optimal ausgenützt werden können.<br />
Die vorgesehene gesetzliche Einführung der CO 2 -<br />
Abgabe wird bei einigen Betrieben zu hohen Kosten und<br />
somit zu Ertragseinbussen führen, wenn keine Branchenlösung<br />
für die Textilindustrie gefunden wird.<br />
Da mit hohen Kosten verbunden, bleiben die zu erwartenden<br />
Raten der betriebsinternen Forschung und Entwicklung<br />
(F&E) bei Werten von weniger als 1% des Umsatzes.<br />
Die Mitgliedschaft der einzelnen Betriebe im Textilverb<strong>and</strong><br />
bleibt wie bisher je nach Betrieb passiv bis aktiv.<br />
In der Variante Minimale Kooperation wird die gegenwärtige<br />
informelle Zusammenarbeit aufgrund lockerer<br />
Vereinbarungen der unterschiedlichen Textilbetriebe auch<br />
die Zukunft prägen. Die heutigen Betriebe und ihre<br />
St<strong>and</strong>orte werden beibehalten, punktuelle Kooperationen<br />
genutzt, intensivere Kooperationen werden nicht speziell<br />
gefördert. Das Produzentennetzwerk ist und bleibt wenig<br />
vernetzt. Einzelne Betriebe sind jedoch bereits stark vertikalisiert.<br />
Die weiterhin selbständigen Betriebe bestimmen<br />
84 UNS-Fallstudie 2002