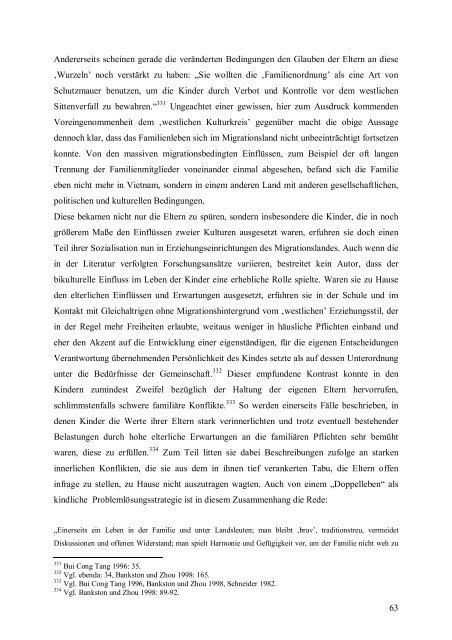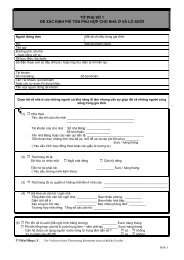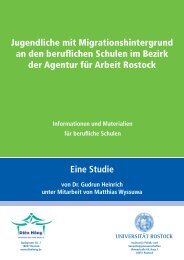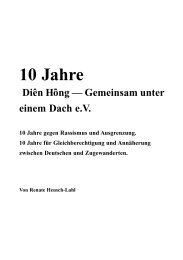Aus allen Quellen trinken - Gemeinsam unter einem Dach e.v.
Aus allen Quellen trinken - Gemeinsam unter einem Dach e.v.
Aus allen Quellen trinken - Gemeinsam unter einem Dach e.v.
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Andererseits scheinen gerade die veränderten Bedingungen den Glauben der Eltern an diese<br />
‚Wurzeln’ noch verstärkt zu haben: „Sie wollten die ‚Familienordnung’ als eine Art von<br />
Schutzmauer benutzen, um die Kinder durch Verbot und Kontrolle vor dem westlichen<br />
Sittenverfall zu bewahren.“ 331 Ungeachtet einer gewissen, hier zum <strong>Aus</strong>druck kommenden<br />
Voreingenommenheit dem ‚westlichen Kulturkreis’ gegenüber macht die obige <strong>Aus</strong>sage<br />
dennoch klar, dass das Familienleben sich im Migrationsland nicht unbeeinträchtigt fortsetzen<br />
konnte. Von den massiven migrationsbedingten Einflüssen, zum Beispiel der oft langen<br />
Trennung der Familienmitglieder voneinander einmal abgesehen, befand sich die Familie<br />
eben nicht mehr in Vietnam, sondern in <strong>einem</strong> anderen Land mit anderen gesellschaftlichen,<br />
politischen und kulturellen Bedingungen.<br />
Diese bekamen nicht nur die Eltern zu spüren, sondern insbesondere die Kinder, die in noch<br />
größerem Maße den Einflüssen zweier Kulturen ausgesetzt waren, erfuhren sie doch einen<br />
Teil ihrer Sozialisation nun in Erziehungseinrichtungen des Migrationslandes. Auch wenn die<br />
in der Literatur verfolgten Forschungsansätze variieren, bestreitet kein Autor, dass der<br />
bikulturelle Einfluss im Leben der Kinder eine erhebliche Rolle spielte. Waren sie zu Hause<br />
den elterlichen Einflüssen und Erwartungen ausgesetzt, erfuhren sie in der Schule und im<br />
Kontakt mit Gleichaltrigen ohne Migrationshintergrund vom ‚westlichen’ Erziehungsstil, der<br />
in der Regel mehr Freiheiten erlaubte, weitaus weniger in häusliche Pflichten einband und<br />
eher den Akzent auf die Entwicklung einer eigenständigen, für die eigenen Entscheidungen<br />
Verantwortung übernehmenden Persönlichkeit des Kindes setzte als auf dessen Unterordnung<br />
<strong>unter</strong> die Bedürfnisse der Gemeinschaft. 332 Dieser empfundene Kontrast konnte in den<br />
Kindern zumindest Zweifel bezüglich der Haltung der eigenen Eltern hervorrufen,<br />
schlimmstenfalls schwere familiäre Konflikte. 333 So werden einerseits Fälle beschrieben, in<br />
denen Kinder die Werte ihrer Eltern stark verinnerlichten und trotz eventuell bestehender<br />
Belastungen durch hohe elterliche Erwartungen an die familiären Pflichten sehr bemüht<br />
waren, diese zu erfüllen. 334 Zum Teil litten sie dabei Beschreibungen zufolge an starken<br />
innerlichen Konflikten, die sie aus dem in ihnen tief verankerten Tabu, die Eltern offen<br />
infrage zu stellen, zu Hause nicht auszutragen wagten. Auch von <strong>einem</strong> „Doppelleben“ als<br />
kindliche Problemlösungsstrategie ist in diesem Zusammenhang die Rede:<br />
„Einerseits ein Leben in der Familie und <strong>unter</strong> Landsleuten; man bleibt ‚brav’, traditionstreu, vermeidet<br />
Diskussionen und offenen Widerstand; man spielt Harmonie und Gefügigkeit vor, um der Familie nicht weh zu<br />
331 Bui Cong Tang 1996: 35.<br />
332 Vgl. ebenda: 34, Bankston und Zhou 1998: 165.<br />
333 Vgl. Bui Cong Tang 1996, Bankston und Zhou 1998, Schneider 1982.<br />
334 Vgl. Bankston und Zhou 1998: 89-92.<br />
63