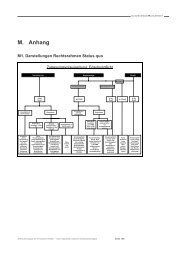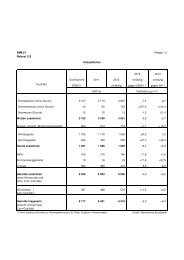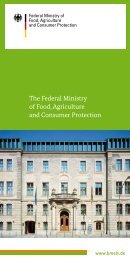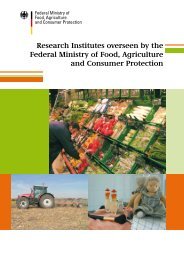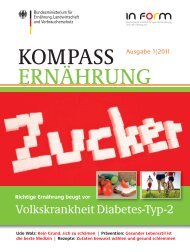Berichte über Landwirtschaft - BMELV
Berichte über Landwirtschaft - BMELV
Berichte über Landwirtschaft - BMELV
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Labyrinth ländliche Entwicklung? Antworten aus der Wissenschaft<br />
205<br />
und des Küstenschutzes“, national finanziert aus Modulationsmitteln, bei denen Bund<br />
und Land die Mittel im Verhältnis 80 zu 20 tragen, bei Inanspruchnahme der maximalen<br />
EU-Kofinanzierung von 80 % für Maßnahmen des Schwerpunktes 2 in Konvergenz-<br />
gebieten) (vgl. 12). Ein solch geringer Eigenanteil ist aber unter Effizienzgesichtspunkten<br />
nur dann zu rechtfertigen, wenn durch die Maßnahmen positive externe Effekte erbracht<br />
werden, deren Nutznießer nahezu vollständig außerhalb des betreffenden Bundeslandes<br />
liegen. Auf der anderen Seite erweist es sich aber in der Praxis häufig als schwierig, die<br />
externen Effekte einer Maßnahme und deren räumliche Verteilung präzise zu bestimmen.<br />
Selbst wenn man unterstellt, dass eine präzise räumliche Zuordnung gelingen könnte (und<br />
dass diese zudem dem politischen Zuschnitt der Gebietskörperschaften entspricht), würde<br />
eine entsprechend variable Ausgestaltung der Kofinanzierungsanteile nicht unerhebliche<br />
Transaktionskosten verursachen, die bei der Effizienzprüfung mit zu veranschlagen wären.<br />
Gleichwohl wäre in der ländlichen Entwicklungspolitik insgesamt eine stärkere Berücksichtigung<br />
des Prinzips der fiskalischen Äquivalenz wünschenswert. Hierfür wäre aber<br />
eine Reihe flankierender Maßnahmen wie eine bessere Finanzausstattung der Regionen<br />
erforderlich.<br />
3 2013+: Quo vadis?<br />
Ländliche Räume unterscheiden sich in vielfältiger Weise voneinander, und es spricht<br />
vieles für eine weitere Ausdifferenzierung in Zukunft. Daher sind Verallgemeinerungen<br />
mit Vorsicht zu interpretieren. Dies gilt auch für die folgenden, beispielhaft aufgeführten<br />
Herausforderungen, vor denen ländliche Räume stehen. Die vielleicht größte Herausforderung<br />
wird es sein, mit den Auswirkungen des demografischen Wandels (Rückgang<br />
und Alterung der Bevölkerung) umzugehen („Management von Schrumpfung“ 2, S. 3).<br />
Dies betrifft nicht nur ländliche Räume (und auch nicht alle ländlichen Regionen werden<br />
einen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen haben); periphere, strukturschwache Regionen<br />
werden aber besonders betroffen sein. Im Zuge der Globalisierung, aber auch der<br />
weiteren Integration innerhalb der EU wird der Wettbewerb der Regionen zunehmen. Die<br />
Entwicklung hin zu wissensbasierten Ökonomien ist insbesondere für Hochlohnländer<br />
und damit auch für Deutschland von Bedeutung. Dies stellt eine Herausforderung für ländliche<br />
Räume dar, da Universitäten oder Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vor<br />
allem in Städten angesiedelt sind. Eine weitere Herausforderung liegt im Klimawandel.<br />
Maßnahmen zum Klimaschutz führen unter anderem dazu, dass Mobilität teurer wird, was<br />
insbesondere Auswirkungen für dünn besiedelte Regionen haben wird.<br />
Die Diskussionen <strong>über</strong> die Förderung ländlicher Räume in der Zeit nach 2013 haben<br />
bereits begonnen. Diese finden in einem politischen Kontext statt, der unter anderem geprägt<br />
wird durch die raumordnungspolitische Rahmensetzung (s. die „Metropoldiskussion“<br />
und die neuen Leitbilder der Raumordnung, 4), die Föderalismusreform II, die im<br />
Hinblick auf Kompetenzverteilung und Subsidiarität relevant ist, die für 2009/2010 vorgesehene<br />
Überprüfung des EU-Haushalts, die Auswirkungen auf die Finanzmittel für die<br />
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP, 1. und 2. Säule) und die Regional- und Strukturpolitik<br />
haben dürfte, und den Health Check der GAP. Der Vorschlag der Kommission (5) sieht<br />
unter anderem vor, die obligatorische Modulation bis 2013 schrittweise von derzeit 5 %<br />
auf 13 % zu erhöhen und damit die 2. Säule der Agrarpolitik zu stärken. Auch diese Diskussion<br />
bestätigt die o. g. Pfadabhängigkeit des Politikfelds: Die Modulation ist keine<br />
Maßnahme, die man dann konzipieren würde, wenn man die Politik zur Entwicklung ländlicher<br />
Räume am Reißbrett entwerfen könnte. Das Aufkommen an Modulationsmitteln,<br />
das maßgeblich von landwirtschaftlichen Produktionsgrößen der Vergangenheit (z. B. Getreideflächen<br />
und -erträge Ende der 1980er-Jahre) und der aktuellen Betriebsgrößenstruk-