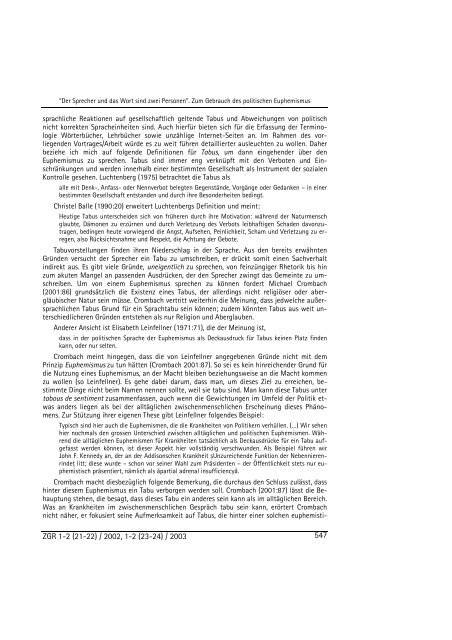NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
NATION UND SPRACHE
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
“Der Sprecher und das Wort sind zwei Personen”. Zum Gebrauch des politischen Euphemismus<br />
sprachliche Reaktionen auf gesellschaftlich geltende Tabus und Abweichungen von politisch<br />
nicht korrekten Spracheinheiten sind. Auch hierfür bieten sich für die Erfassung der Terminologie<br />
Wörterbücher, Lehrbücher sowie unzählige Internet-Seiten an. Im Rahmen des vorliegenden<br />
Vortrages/Arbeit würde es zu weit führen detaillierter ausleuchten zu wollen. Daher<br />
beziehe ich mich auf folgende Definitionen für Tabus, um dann eingehender über den<br />
Euphemismus zu sprechen. Tabus sind immer eng verknüpft mit den Verboten und Einschränkungen<br />
und werden innerhalb einer bestimmten Gesellschaft als Instrument der sozialen<br />
Kontrolle gesehen. Luchtenberg (1975) betrachtet die Tabus als<br />
alle mit Denk-, Anfass- oder Nennverbot belegten Gegenstände, Vorgänge oder Gedanken – in einer<br />
bestimmten Gesellschaft entstanden und durch ihre Besonderheiten bedingt.<br />
Christel Balle (1990:20) erweitert Luchtenbergs Definition und meint:<br />
Heutige Tabus unterscheiden sich von früheren durch ihre Motivation: während der Naturmensch<br />
glaubte, Dämonen zu erzürnen und durch Verletzung des Verbots leibhaftigen Schaden davonzutragen,<br />
bedingen heute vorwiegend die Angst, Aufsehen, Peinlichkeit, Scham und Verletzung zu erregen,<br />
also Rücksichtsnahme und Respekt, die Achtung der Gebote.<br />
Tabuvorstellungen finden ihren Niederschlag in der Sprache. Aus den bereits erwähnten<br />
Gründen versucht der Sprecher ein Tabu zu umschreiben, er drückt somit einen Sachverhalt<br />
indirekt aus. Es gibt viele Gründe, uneigentlich zu sprechen, von feinzüngiger Rhetorik bis hin<br />
zum akuten Mangel an passenden Ausdrücken, der den Sprecher zwingt das Gemeinte zu umschreiben.<br />
Um von einem Euphemismus sprechen zu können fordert Michael Crombach<br />
(2001:86) grundsätzlich die Existenz eines Tabus, der allerdings nicht religiöser oder abergläubischer<br />
Natur sein müsse. Crombach vertritt weiterhin die Meinung, dass jedwelche außersprachlichen<br />
Tabus Grund für ein Sprachtabu sein können; zudem könnten Tabus aus weit unterschiedlicheren<br />
Gründen entstehen als nur Religion und Aberglauben.<br />
Anderer Ansicht ist Elisabeth Leinfellner (1971:71), die der Meinung ist,<br />
dass in der politischen Sprache der Euphemismus als Deckausdruck für Tabus keinen Platz finden<br />
kann, oder nur selten.<br />
Crombach meint hingegen, dass die von Leinfellner angegebenen Gründe nicht mit dem<br />
Prinzip Euphemismus zu tun hätten (Crombach 2001:87). So sei es kein hinreichender Grund für<br />
die Nutzung eines Euphemismus, an der Macht bleiben beziehungsweise an die Macht kommen<br />
zu wollen (so Leinfellner). Es gehe dabei darum, dass man, um dieses Ziel zu erreichen, bestimmte<br />
Dinge nicht beim Namen nennen sollte, weil sie tabu sind. Man kann diese Tabus unter<br />
tabous de sentiment zusammenfassen, auch wenn die Gewichtungen im Umfeld der Politik etwas<br />
anders liegen als bei der alltäglichen zwischenmenschlichen Erscheinung dieses Phänomens.<br />
Zur Stützung ihrer eigenen These gibt Leinfellner folgendes Beispiel:<br />
Typisch sind hier auch die Euphemismen, die die Krankheiten von Politikern verhüllen. (…) Wir sehen<br />
hier nochmals den grossen Unterschied zwischen alltäglichen und politischen Euphemismen. Während<br />
die alltäglichen Euphemismen für Krankheiten tatsächlich als Deckausdrücke für ein Tabu aufgefasst<br />
werden können, ist dieser Aspekt hier vollständig verschwunden. Als Beispiel führen wir<br />
John F. Kennedy an, der an der Addisonschen Krankheit [Unzureichende Funktion der Nebennierenrinde]<br />
litt; diese wurde – schon vor seiner Wahl zum Präsidenten – der Öffentlichkeit stets nur euphemistisch<br />
präsentiert, nämlich als `partial adrenal insufficiency`.<br />
Crombach macht diesbezüglich folgende Bemerkung, die durchaus den Schluss zulässt, dass<br />
hinter diesem Euphemismus ein Tabu verborgen werden soll. Crombach (2001:87) lässt die Behauptung<br />
stehen, die besagt, dass dieses Tabu ein anderes sein kann als im alltäglichen Bereich.<br />
Was an Krankheiten im zwischenmenschlichen Gespräch tabu sein kann, erörtert Crombach<br />
nicht näher, er fokusiert seine Aufmerksamkeit auf Tabus, die hinter einer solchen euphemisti-<br />
ZGR 1-2 (21-22) / 2002, 1-2 (23-24) / 2003<br />
547